Wie an anderen Höfen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
zu beobachten, betrieb auch Herzog Eberhard III. eine Systematisierung
der Sammlungsbestände. Die nach Sammlungsgruppen geordneten
Inventare belegten nun die Neuaufstellung der als Preziosen,
Naturalien, Exotika, Gemälde und technischen Instrumente
gefassten Bereiche. Die anhaltende Tendenz zur Systematisierung
und Verwissenschaftlichung der Kunstkammer belegt auch die Tätigkeit
des besonders in den Naturwissenschaften qualifizierten Antiquars
Johann Schuckard, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein Inventar
anlegte, das detailliertere Beschreibungen der Objekte und ihrer
Standorte bot, als die Inventare seiner Vorgänger. Das Schuckardsche
Inventar verweist schon auf die Verlagerung der Sammlungsinteressen
der Herzöge Eberhard Ludwig (reg. 1693–1733) und Carl
Alexander (reg. 1733–1737). Dieser ließ die Ludwigsburger
Gemäldegalerie als eine neue Form fürstlicher Repräsentation
im Kontext absolutistischer Schlossarchitektur anlegen.
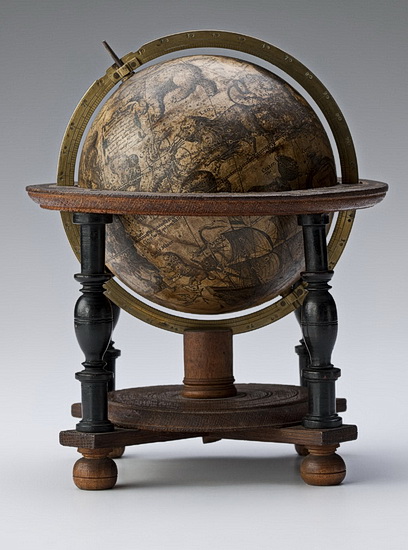
Himmelsglobus.
Werkstatt Willem Janszoon Blaeu (1571–1638) Amsterdam, nach
1640.
Landesmuseum Württemberg, Stuttgart. ©
H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
Während die Fürsten einerseits aufwendige Schlossbauten
errichteten, wandelten schon vor der Mitte des 18. Jahrhunderts
einige fürstliche Sammler in Kassel, Braunschweig und Dresden
ihre Kunstkammern in öffentlich zugängliche Schau-
und Lehrsammlungen um und errichteten eigene Gebäude für
Kunst-, Münz- und Naturalienkabinette. Für die württembergische
Kunstkammer lassen sich für die zweite Hälfte des 18.
Jahrhunderts in den mehrfachen räumlichen Verlagerungen
und den Differenzierungen der Sammlungsbereiche veränderte
Identifikationen der Herzöge mit den Sammlungen erkennen.
Während nur noch wenige Zugänge in die Kunstkammer
gelangten, wurden zahlreiche Gemälde und Kupferstiche aus
ihren Beständen an das Ludwigsburger Schloss übermittelt.
Seit den 1780er Jahren wurden zunächst die Bestände
des Naturalien-, später des Münzkabinetts an die Stuttgarter
Hohe Carlsschule verbracht, wo sie als Lehrsammlungen dienten.
König Wilhelm I. von Württemberg (reg. 1816–1864)
löste die Sammlungen aus der Hofverwaltung und veranlasste
die Eingliederung in die Staatsverwaltung. Die von Münz-
und Naturalienkabinett getrennte Kunstsammlung wurde als „Königliches
Kunstkabinett“ der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. 1886 wurde die Kunstkammer der 1862 gegründeten
Staatssammlung vaterländischer Altertumsdenkmale als gesonderter
Bestand übergeben. Nach dem Ende der Monarchie ging die
Kunstkammer 1927 in Landesbesitz über.
|