Die Bestände der Antikensammlung des Landesmuseums Württemberg
umfassen Objekte der Griechen, Etrusker und Römer, die von
der griechischen Bronzezeit im 3. Jahrtausend vor Christus bis
ins 5. Jahrhundert nach Christus datieren. Sie erlauben einen
umfangreichen Blick in die Kultur, Glaubens- und Gedankenwelt
der Griechen, Etrusker und Römer, die den antiken Mittelmeerraum
entscheidend prägten. Religion, Totenkult und Jenseitsvorstellungen
sowie die Selbstdarstellung der Elite werden in der Neupräsentation
eingehend behandelt.
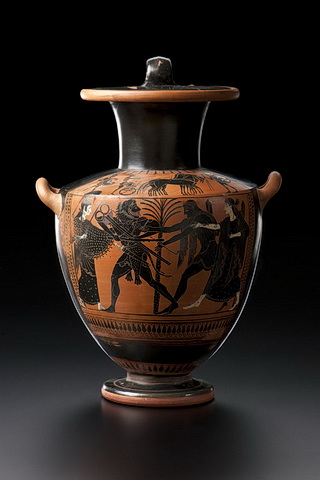 Zwar sind speziell zur Geschichte der Griechen und Römer
vielfältige schriftliche Zeugnisse überliefert, doch
es sind die materiellen Hinterlassenschaften, die Rückschlüsse
auch zu den Aspekten erlauben, die in den Schriftzeugnissen kaum
beleuchtet werden. Für die Etrusker, von denen zwar Inschriften
erhalten geblieben sind, deren Sprache auch lesbar, aber nur
teilweise übersetzbar ist, stellen die archäologischen
Zeugnisse gar den einzigen Zugang zur Glaubens- und Vorstellungswelt
dar. Zwar sind speziell zur Geschichte der Griechen und Römer
vielfältige schriftliche Zeugnisse überliefert, doch
es sind die materiellen Hinterlassenschaften, die Rückschlüsse
auch zu den Aspekten erlauben, die in den Schriftzeugnissen kaum
beleuchtet werden. Für die Etrusker, von denen zwar Inschriften
erhalten geblieben sind, deren Sprache auch lesbar, aber nur
teilweise übersetzbar ist, stellen die archäologischen
Zeugnisse gar den einzigen Zugang zur Glaubens- und Vorstellungswelt
dar.
Hydria mit Darstellung „Heracles mit Apoll im Streit
um den delphischen Dreifuß“. Fundort unbekannt,
um 510 v. Chr. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
© H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
Die Objekte, die die Antikensammlung zu Griechen, Römern
und Etruskern beheimatet, reichen von kykladischen und mykenischen
Idolen über griechische Vasen, hellenistische Skulpturen
und etruskische Bronzearbeiten bis zu filigranem Goldschmuck,
römischen Kaiserbildnissen und Wandmalereien. Sie belegen
nicht nur Blüte und Reichtum der antiken Kulturen, sondern
auch ihre vielfältigen Kontakte und die gegenseitige Beeinflussung.
Sie zeugen aber auch von der reichen Bilderwelt der Antike. Das
Bild war ein wichtiges Medium, gleichgültig auf welchem
Bildträger es angebracht oder aus welchem Material es gefertigt
wurde. Bilder waren bedeutende Mittel der Kommunikation in den
antiken Gesellschaften und dienten unter anderem der herrschenden
Klasse zur Verbreitung von politischen und ideellen Leitvorstellungen.
Derartige Bilder der Macht belegen zugleich auch die Macht der
Bilder.
 Einen Schwerpunkt der Sammlung bilden die Objekte aus der Zeit
des griechisch-römischen Ägyptens, die der Stuttgarter
Industrielle Ernst von Sieglin zu Beginn des 20. Jahrhunderts
gestiftet hat. Die einzigartigen Stücke sind eindrucksvolle
Zeugnisse des Austauschprozesses zwischen der jahrtausendealten
Tradition in Ägypten mit der griechischen und römischen
Kultur und belegen die Vielfalt einer antiken multikulturellen
Gesellschaft. Zur Sammlung Ernst von Sieglins gehören Marmorbildnisse
unter anderem von Alexander dem Großen und Kaiser Augustus,
eindrucksvolle Mumienmasken sowie Bronzen und Terrakotten von
höchster Qualität. Ein besonderes Highlight sind mehrere
farbenprächtige Mumienporträts, die auf dünne
Holztafeln gemalt wurden und zu den äußerst seltenen
Beispielen antiker Malerei zählen, die bis heute erhalten
geblieben sind; sie kombinieren die ägyptischen Begräbnissitten
mit der römischen Tafelmalerei und Porträtkunst. Einen Schwerpunkt der Sammlung bilden die Objekte aus der Zeit
des griechisch-römischen Ägyptens, die der Stuttgarter
Industrielle Ernst von Sieglin zu Beginn des 20. Jahrhunderts
gestiftet hat. Die einzigartigen Stücke sind eindrucksvolle
Zeugnisse des Austauschprozesses zwischen der jahrtausendealten
Tradition in Ägypten mit der griechischen und römischen
Kultur und belegen die Vielfalt einer antiken multikulturellen
Gesellschaft. Zur Sammlung Ernst von Sieglins gehören Marmorbildnisse
unter anderem von Alexander dem Großen und Kaiser Augustus,
eindrucksvolle Mumienmasken sowie Bronzen und Terrakotten von
höchster Qualität. Ein besonderes Highlight sind mehrere
farbenprächtige Mumienporträts, die auf dünne
Holztafeln gemalt wurden und zu den äußerst seltenen
Beispielen antiker Malerei zählen, die bis heute erhalten
geblieben sind; sie kombinieren die ägyptischen Begräbnissitten
mit der römischen Tafelmalerei und Porträtkunst.
Bildnis eines Priesters oder eines hohen Beamten.
Buto (Ägypten), 1. Jh. v. Chr. Landesmuseum
Württemberg, Stuttgart
©
H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart Die Sammlung zur Antike ist über Jahrhunderte gewachsen.
In den frühesten Anfängen gehen ihre Bestände
noch auf die Kunst- und Wunderkammer der Herzöge von Württemberg
zurück, die im Unterschied zu anderen europäischen
Fürsten nicht gezielt antike Objekte aus dem Mittelmeerraum
sammelten. Entscheidenden Zuwachs erhielt sie allerding erst
im 19. und 20. Jahrhundert, als durch Schenkungen und geplante
Ankäufe Teile verschiedener Privatsammlungen in den Besitz
des Landesmuseums Württemberg, beziehungsweise von dessen
Vorgängerinstitution, der Königlichen Staatssammlung
Vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale, gelangten. |