Wenn uns die Antike heute marmorweiß erscheint, so täuscht
dieser Eindruck, denn der antike Alltag war sehr stark von Farbigkeit
bestimmt. Nicht nur waren alle steinernen Skulpturen und tönernen
Statuetten bunt bemalt, sondern die Kunst der Antike war generell
in hohem Maße von einer vielfarbigen wie vielfältigen
Bilderwelt gekennzeichnet, die eine große Bandbreite an
Motiven und Themen aufweist und ein Spiegel der griechischen,
etruskischen und römischen Lebenskultur ist. Dementsprechend
groß ist die Bilderfülle, die auf verschiedenen Bildträgern – z.
B. Vasen, Reliefs, Wandmalereien und Mosaiken – überliefert
ist. Die Auswahl der Bildthemen erfolgte dabei aber nicht willkürlich,
denn die Bilder dienten keineswegs einzig der bloßen Dekoration;
vielmehr standen Aussagen und Botschaften dahinter, die sich
an den Betrachter richteten. Das Bild war ein bedeutendes Medium
und diente der Kommunikation innerhalb der Gesellschaft.
 Besonders bevorzugt wurden Darstellungen mythischer Geschichten
von Göttern und Helden. Neben Szenen aus den großen
Mythen über die olympischen Götter wie Zeus oder vergöttlichte
Heroen wie Herakles erfreuten sich vor allem die homerischen
Epen zum Trojanischen Krieg oder zu den Irrfahrten des Odysseus
besonderer Beliebtheit. Durch Handelskontakte und den kulturellen
Austausch mit den griechischen Kolonien in Italien hielten Szenen
wie das Paris-Urteil oder Achills Kampf gegen die Amazonenkönigin
Penthesileia sogar in die Bilderwelt der Etrusker Einzug. Auch
in Rom dominierten griechische Mythen die heimischen Bilderwelten:
Sie sind das häufigste Motiv auf Wandmalereien in römischen
Häusern. Sie sollten sowohl die Bildung des Hausherrn unterstreichen
als auch die Funktion eines Raumes hervorheben: In Schlafräumen
etwa wurden gerne die Liebschaften des Zeus dargestellt, farbenprächtige
Beispiele dafür finden sich auch im Landesmuseum Württemberg. Besonders bevorzugt wurden Darstellungen mythischer Geschichten
von Göttern und Helden. Neben Szenen aus den großen
Mythen über die olympischen Götter wie Zeus oder vergöttlichte
Heroen wie Herakles erfreuten sich vor allem die homerischen
Epen zum Trojanischen Krieg oder zu den Irrfahrten des Odysseus
besonderer Beliebtheit. Durch Handelskontakte und den kulturellen
Austausch mit den griechischen Kolonien in Italien hielten Szenen
wie das Paris-Urteil oder Achills Kampf gegen die Amazonenkönigin
Penthesileia sogar in die Bilderwelt der Etrusker Einzug. Auch
in Rom dominierten griechische Mythen die heimischen Bilderwelten:
Sie sind das häufigste Motiv auf Wandmalereien in römischen
Häusern. Sie sollten sowohl die Bildung des Hausherrn unterstreichen
als auch die Funktion eines Raumes hervorheben: In Schlafräumen
etwa wurden gerne die Liebschaften des Zeus dargestellt, farbenprächtige
Beispiele dafür finden sich auch im Landesmuseum Württemberg.
Leda mit dem Schwan.
380/370 v. Chr. Landesmuseum Württemberg,
Stuttgart
©
P. Frankenstein, H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg,
Stuttgart
Ein besonders breites Spektrum an unterschiedlichen Motiven
zeigen die Darstellungen auf griechischen Vasen: Diese bilden
nicht nur die bereits angesprochenen mythischen Wesen, Götter
oder Heroen ab, sondern auch Szenen aus der Lebenswelt: Männerrunden
beim Symposion – manchmal in der Gesellschaft von Hetären,
Athleten beim Training im Gymnasion, Liebeswerbungen, Krieger
im Kampf, Damen beim Schminken und bei der Kleiderauswahl oder
sogar Töpfer bei der Arbeit an der Töpferscheibe. Solche
Bilder erlauben Einblicke in Aspekte des täglichen Lebens,
die in den Schriftquellen nur selten so detailliert geschildert
werden. Zugleich ermöglichen sie Rückschlüsse
darüber, welche Bereiche des Alltags als so prägend
empfunden wurden, dass sie als angemessener Gegenstand für
die Kunstfertigkeit der Vasenmaler galten. Im Wandel der Motive
lassen sich dabei auch Veränderungen im Zeitgeist beobachten,
wie das Beispiel der besonderen Bedeutung zeigt, die Krieg und
Kampf im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus für die Lebensrealität
hatten. In dieser Zeit kämpften nicht nur die einzelnen
Stadtstaaten um die Vormachtstellung, sondern die griechische
Freiheit war durch die Großmacht der Perser bedroht. In
Vasenmalereien schlägt sich dies etwa in der Beliebtheit
des Motivs des Kriegerabschieds nieder: Auf einer Bauchamphora
verabschiedet sich ein Gerüsteter von seiner Frau. Szenen
wie diese sollten an die Möglichkeit des eigenen Todes auf
dem Schlachtfeld erinnern, thematisierten aber zugleich auch
die Möglichkeit eines ruhmreichen, ehrenvollen Todes „für
eine gute Sache“.

Griechische Trinkschale mit Sportdarstellungen, um 500 v.
Chr. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
©
P. Frankenstein, H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg,
Stuttgart
Durch alle Zeiten beliebt waren Athletendarstellungen wie die
von Diskuswerfern oder Ringern, die das männliche Leistungsethos
zum Ausdruck bringen sollten. Das Training des Körpers war
von Bedeutung, um sich anderen gegenüber auszuzeichnen,
zugleich aber auch unerlässlich für den Kampf und die
Verteidigung des Gemeinwesens. Ein gestählter Körper
zählte zudem auch zu den Wesensmerkmalen der moralischen
und geistigen Vollkommenheit – kalos kai agathos (= gut
und schön) galt als Ideal der griechischen Gesellschaft.
Die körperliche Ertüchtigung spielte vor allem in der
Erziehung der Jugend zur Elite eine zentrale Rolle.
Häufiger finden sich bei den Athletendarstellungen auch
Inschriften wie o pais kalos (= der Knabe ist schön). Diese
sogenannten Lieblingsinschriften sind vielfach auf Vasen schönen
jungen Männern und ihren Vorzügen gewidmet, manchmal
werden die Bewunderten auch namentlich genannt. Auf der Stuttgarter
Duris-Schale mit Sportdarstellungen ist dies ein gewisser Chairestratos.
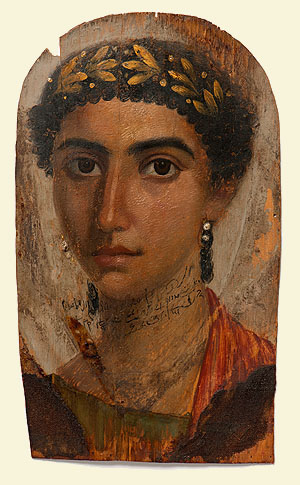 Auch
Kulturkontakt und Kulturtransfer schlugen sich besonders deutlich
in Bildern nieder: Bildinhalte wurden dabei ebenso tradiert
und neu aufgenommen wie Formensprache oder spezielle Techniken
in der Malerei. Ein einzigartiges Beispiel für Akkulturationsprozesse
sind die farbenprächtigen Mumienporträts aus dem römischen Ägypten.
Schon seit der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen
hatte sich hier die jahrtausendealte pharaonische Tradition mit
der der griechischen Kultur vermischt. Nach der Eroberung durch
die Römer im Jahr 30 vor Christus kam dann auch der römische
Kultureinfluss zum Tragen. Mumienporträts sind auf dünne
Holztafeln gemalte Porträts, die in die Bandagen am Kopfteil
von Mumien eingebunden wurden. Sie entstanden, als die Jenseitsvorstellungen
und der Totenkult der gemischten ägyptisch-griechischen
Bevölkerung auf die römische Bildnistradition und Tafelmalerei
trafen. Das Stuttgarter Mumienporträt der Eirene belegt
besonders eindrucksvoll die multikulturelle Gesellschaft des
römischen Ägyptens. Eine Inschrift nennt hier den Namen
der Toten: „Eirene, Tochter des Silvanos und der Senpnoutis“.
Während Eirenes Vater einen Namen römischen Ursprungs
trägt, ist der Name ihrer Mutter ägyptisch und ihr
eigener typisch griechisch. Auch
Kulturkontakt und Kulturtransfer schlugen sich besonders deutlich
in Bildern nieder: Bildinhalte wurden dabei ebenso tradiert
und neu aufgenommen wie Formensprache oder spezielle Techniken
in der Malerei. Ein einzigartiges Beispiel für Akkulturationsprozesse
sind die farbenprächtigen Mumienporträts aus dem römischen Ägypten.
Schon seit der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen
hatte sich hier die jahrtausendealte pharaonische Tradition mit
der der griechischen Kultur vermischt. Nach der Eroberung durch
die Römer im Jahr 30 vor Christus kam dann auch der römische
Kultureinfluss zum Tragen. Mumienporträts sind auf dünne
Holztafeln gemalte Porträts, die in die Bandagen am Kopfteil
von Mumien eingebunden wurden. Sie entstanden, als die Jenseitsvorstellungen
und der Totenkult der gemischten ägyptisch-griechischen
Bevölkerung auf die römische Bildnistradition und Tafelmalerei
trafen. Das Stuttgarter Mumienporträt der Eirene belegt
besonders eindrucksvoll die multikulturelle Gesellschaft des
römischen Ägyptens. Eine Inschrift nennt hier den Namen
der Toten: „Eirene, Tochter des Silvanos und der Senpnoutis“.
Während Eirenes Vater einen Namen römischen Ursprungs
trägt, ist der Name ihrer Mutter ägyptisch und ihr
eigener typisch griechisch.
Mumienporträt der Eirene. Ägypten, 40/50 n. Chr.
Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
Foto © H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
|