Abgehoben -
6000 Jahre Pfahlbauten in Europa und Südostasien
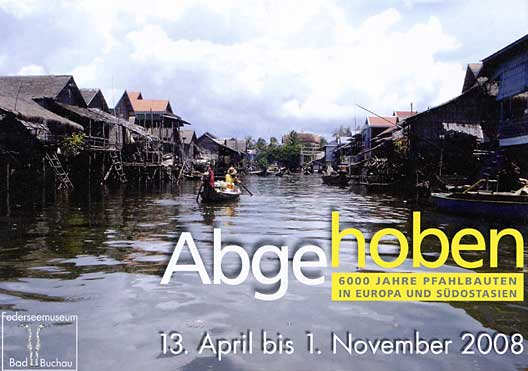
Das Haus - mehr als nur Wohnen
Nicht jeder hat in unserer Gesellschaft sein eigenes Zuhause,
eingebunden in eine überschaubare Nachbarschaft. Wenige
nur leben heute noch in dem Haus, in dem sie ihre Kindheit
erlebt haben. Wohnen ist in unserer mobilen Gesellschaft
kaum noch mit dem Gefühl einer festen Verbundenheit an eine
bestimmte räumliche oder soziale Umgebung verknüpft. Vielfach
wohnt man nebeneinander, nicht miteinander, individuell
und anonym. Die sozialen Formen des Wohnens und der Wohngemeinschaften
haben sich verändert.
Auch in den indigenen Gemeinschaften in Ländern der Dritten
Welt hat sich das Bauen und Wohnen mit der Globalisierung
und einer verstärkten Mobilität gewandelt. Fast alle dieses
Kulturen befinden sich im Umbruch. Doch ist hier in diesen
stark traditionell orientierten Gesellschaften immer noch
eine starke Bindung des Einzelnen an die Verwandtschaftsgruppe
gegeben, die mit dem Elternhaus und der Hausgemeinschaft
assoziiert wird. Das gilt insbesondere dort, wo mit dauerhaft
errichteten Häusern eine permanente Raumgebundenheit geben
ist und sich im Haus die kulturelle Identität manifestiert.
Haus und Siedlungsgemeinschaft - das "Dorf" - sind nach
wie vor Mittelpunkt ihrer Bezugswelt.
Pfahlbauten in Südostasien - Konstruktion, Funktion und
Symbolik
In vielen indigenen Gesellschaften des insularen Südostasiens
repräsentiert das Haus die Einheit seiner Bewohner als Teil
einer Siedlungs- und Sozialgemeinschaft. Es gibt allen ein
Zuhause, den Lebenden und den Ahnen, den Göttern und den
Geistern. In diesen Gesellschaften wird das Haus zum Symbol
verschiedener Ordnungsprinzipien - es repräsentiert den
Kosmos von überirdischer und irdischer Welt.
Ganz besonders kommt dieses Denken in der Konstruktion der
Pfahlbauten zum Ausdruck, die in ihrer vertikalen Struktur
die Teilung des Makrokosmos in drei Bereiche symbolisieren:
Der Dachkörper als Sinnbild der Oberwelt ist Sitz der Götter
und der Ahnen, der Wohnbereich als Ort der Lebenden, der
ebenerdige Raum zwischen den Pfosten Abbild der Unterwelt.
Zudem weist die horizontale Raumaufteilung als weiteres
grundlegendes Merkmal der südostasiatischen Architektur
jedem Bewohner nach Alter und Geschlecht seinem ihm eigenen
Platz zu.
Die beeindruckenden großen Häuser sind oftmals Mehrfamilienhäuser,
die dem einzelnen Mitglied eine starke Bindung an die Verwandtschaftsgruppe
vermitteln. Es sind Stammhäuser, an die sich die Gruppe
gebunden fühlt und die nicht nur soziales, sondern auch
religiös-rituelles Zentrum der Familie sind.
150 Jahre Pfahlbauforschung
Als im Winter 1853/54 in Obermeilen am Zürichsee Funde
und Pfahlstellungen zum Vorschein kamen, die als Reste vorgeschichtlicher
Dörfer erkannt und mit dem Begriff "Pfahlbauten" belegt
wurden, löste dies ein wahres Pfahlbaufieber aus. Innerhalb
kürzester Zeit wurden an nahezu allen Alpenrandseen und
in vielen Mooren Pfahlbausiedlungen entdeckt. Erstmals rückten
in Europa Siedlungen der Jungsteinzeit und Bronzezeit in
das Blickfeld der noch jungen Altertumsforschung.
Doch angesichts der damaligen Grabungstechnik ließen sich
klare Baufunde kaum beobachten. Stattdessen bediente man
sich bei der Deutung der Überreste ethnographischer Reiseberichte
aus Südostasien und rekonstruierte das Pfahlbaudorf vom
Zürichsee nach der Abbildung einer Pfahlbausiedlung von
Dumont d`Urville in der Doreh-Bucht im Nordwesten Neuguineas,
die zwanzig Jahre zuvor entstanden war.
Die ganz im Geist der Spätromatik und des Historismus getragenen
Vorstellungen von Dörfern auf Pfählen wurde schnell populär
und avancierte zum Ideal "urzeitlicher Ufer- und Moorsiedlungen".
Die Idee vom Dorf, erbaut auf einer Plattform weit draußen
im See und nur über einen Steg mit dem Ufer verbunden, hat
bis heute zu einer anhaltenden Popularisierung der Pfahlbauten
geführt.
Gemeinsam leben, gemeinsam wohnen - 6000 Jahre Pfahlbauten
Mit vielen Mythen hat die moderne Pfahlbauforschung inzwischen
aufgeräumt. Dank der systematischen dendrochronologischen
Untersuchung der Pfahlfelder in den alpennahen Seen und
Mooren ist es inzwischen gelungen, 3800 Jahre Besiedlungsgeschichte
- von der späten Jungsteinzeit bis in die frühe Eisenzeit
- detailgetreu zu verfolgen.
Zusammenhänge zwischen Siedlungsdynamik, Seespiegelschwankung
und Klimaveränderung sowie der Wandel von Siedlungssystemen
und Wirtschaftsformen sind ebenso Themen der aktuellen Forschung
wie technische Innovationen oder Kulturkontakte.
Und dennoch sind viele Fragen allein anhand archäologischer
Daten nur unzureichend zu beantworten: Wie überliefern sich
"Familien", "Haushalte" oder andere "soziale Gemeinschaften"
im archäologischen Befund? Wie lassen sich soziale Handlungen
mit architektonischen Strukturen und archäobiologischen
Daten verknüpfen? Und welche sozialen und ökonomischen Interpretationen
sind denkbar?
Diesen und anderen Fragen versucht sich die Ausstellung
auf spannenden Weise zu nähern. Um Antworten entwerfen zu
können, werden unterschiedliche Konzepte der Hauskonstruktion,
der Raumordnung und Raumwahrnehmung verschiedener ethnischer
Gruppen Kambodschas und Indonesiens präsentiert und den
prähistorischen Pfahlbauten aus Mitteleuropa gegenübergestellt.
|