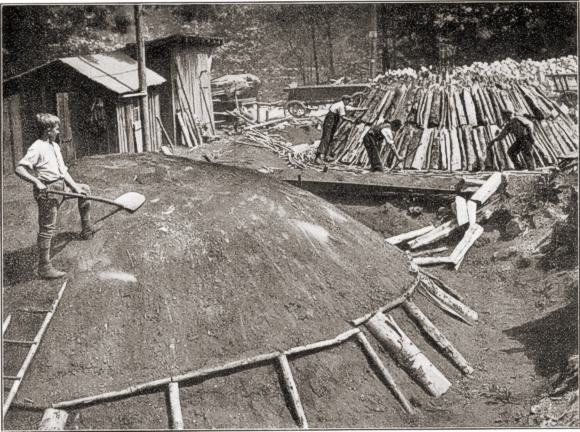[S.33] Während unten im Murgtal Großgewerbe
aller Art, vor allem die Holz- und Eisenwerkarbeit, Kraftfahrwerke,
die Eisenbahn, die Kraftwerkanlagen der Schwarzenbach-Murgtalelektrizität
das ehemals so stille Land mit Lärm und Lebtag und Hast
erfüllen, bleiben die Höhen der Natur verbunden, dem
Bauerntum, den Waldleuten. Man sieht viele hochgewachsene Leute
mit starken, knochigen Gesichtern „wie aus Holz geschnitten" in
der Landschaft, auch Männer mit lockigen Andreas-Hofer-Värten
durch die Waldwege gehen mit langen Schritten, die Axt auf dem
Nucken. Und diese tirolisch anmutenden Männer, Einheimische,
erweisen sich bei tieferer Nachforschung tatsächlich als
Nachkommen eingewanderter Tiroler oder Kärntner.
 Die Industrie hat dem Murgtal und auch den Ortschaften, die
in die Hänge und Tälchen abseits hineingeborgen sind,
fremden Zuzug gebracht. Das hat wie überall dem Volkstum
mehr genommen als gegeben, das ist nie und nirgends aufzuhalten. Die Industrie hat dem Murgtal und auch den Ortschaften, die
in die Hänge und Tälchen abseits hineingeborgen sind,
fremden Zuzug gebracht. Das hat wie überall dem Volkstum
mehr genommen als gegeben, das ist nie und nirgends aufzuhalten.
Dem Volkscharakter und der Mundart nach sind die Bewohner des
Ufgaus vorwiegend alemannisch geartet. Dem Schwäbischen
zu schwäbeln sie halt mehr, und bei Rastatt vorne im Murgtal
mischt sich das Fränkische ein. Zwischen Oos und Murg |
[S. 34] liegt ohnedies die Mundartschwelle. In Lichtental heißt
eine Nadel e Guf, eine böse Frau e bös Wiib, eine Maus
e Muus. Iiewele, Grumbiire, Gugumere un Zwetschge gedeihen prächtig.
Aber den Fingerhüten an der „Gäle Eich" schaukeln
Pfifhölderle (Schmetterlinge), auch muß man dort achtgeben,
daß man sich nicht in einen Haufen Klamhooge (Ameisen)
setzt. Die Kinder dürfen im Sommer nach dem z'Obezehre noch
ein wenig uf d'Gaß, und wenn es z'Obeläut, geben sie
einander den Letschtdatsch. Wenn es wetterleuchtet, so heißt
es: 's kühlt sie a. Hagelkörner sind Kitzelbuhne, der
Mund ist allemal e Muul oder e Labb. Im Haus wohnen noch Huuslitt.
Die Feuerwehr wird alarmiert, und die Nachbarin berichtet: „Sie
hän gsait, daß es in der Stadt, in der Schübestroß,
arig brenne dät." Braut und Bräutigam heißen
Hochzeiter und Hochzeitere, aber auch Hochzitter und Hochzittere.
Wenn man die Kinder bedrohen will, so ruft man ihnen zu: „Mei,
der Nachgrabb holt di. I setz der jetzt glei der Kopf zwische
d'Ohre." Oder: „Hit Nacht musch zur Stroof barfießig
ins Bett." Wer duckmäusig ist, dem wird gesagt: „Mach
nit so dumm wie e Klosterhutzel." Es heißt aber auch: „Die
isch wunderfitzig wie e Klosterhutzel."
Das ganze Oostal entlang wird ähnlich gesprochen in niederalemannischer
Art, die in Oos und Scheuern und Balg noch wuchtiger und gedehnter
und auch mit größerem Wortschatz in Übung ist.
Gegen den Rhein zu, in Sinzheim zum Beispiel, nähert sich
die Mundart dem Hanauerischen. Auch die Rheindörfer Plittersdorf,
Ottersdorf, Söllingen, Wintersdorf berühren in vielem
das westliche Geschwister im Elsaß.
Im Hinteren Murgtal klingt das Schwäbische an. Die Dörfer
zeigen in ihrer baulichen Anlage keine auffallenden Besonderheiten.
Sie machen nicht den kennzeichnenden einheit- | [S. 35] lichen
Eindruck wie die Siedlungen des Renchtales etwa. Das Fachwerkhaus
herrscht
vor in dieser holzreichen Gegend. In
Langenbrand, in Weisenbach, in Schönmünzach und Raumünzach,
im Holzmacherdorf Kirschbaumwasen wird ein rauhes Alemannisch
gesprochen. Die Kinder singen einen hübschen Beschwörungsvers
beim geduldigen Pfeifenklopfen:
Ziff, zaff, ziide,
Schlange in de Wiide (Weiden),
Krodde in de Bäch,
Daß mei Päberle nit verbrech.
Das muss „ub'raffelt", das heißt unbeobachtet
und unbesprochen geschehen. Zu den Himbeeren sagen sie in alter
Form die Hindlbeere. Sie gehen in d'Schuel mit dem Buech. Hand
wie die Mehrzahl Hände bezeichnen sie mit Häng.
In den Murgtalgemeinden ist die Festesfreude nicht sehr brauchtumhaltig
vertieft. Nur bei den Hochzeitsfeiern hat sich eine gewisse Überlieferung
erhalten; auch sie wurde sehr selten. Früher wurde meist
erst nachts der Hochzittere und dem Hochzitter der Hochzitsmaie
in die festliche Stube getragen, und die Mädchen brachten
Geschenke dar, mit langen Gedichten überreicht, dabei auch
eine verdeckte Suppenschüssel, die der Hochzitter öffnen
musste. Sie war mit Kindlessachen gefüllt. Erst wenn der
Hochzeitsmaien überreicht war, durfte das Paar sich entfernen.
An manchen Orten wurde der Maien auch früher, etwa beim
Beginn des Mahles, überreicht. |
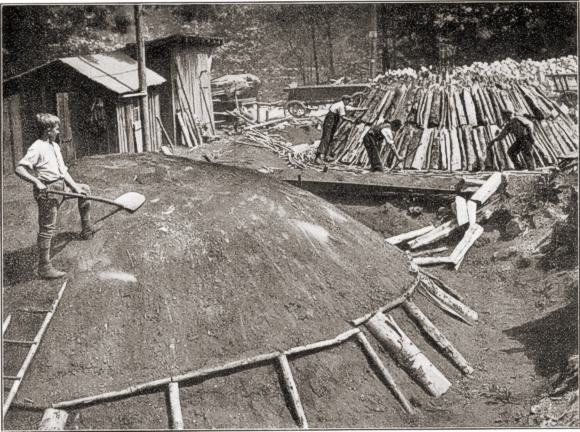
Kohlenmeiler bei Raumünzach. Bad. Heimat 1937 S. 44
Bild oben: Zimmer- und Holzplatz bei Bermersbach. Im Hintergrund
am Hang die für das Murgtal typischen Heustadel. Bad. Heimat
1937 S. 46
[S. 36] Von der Tracht hört man nichts
mehr. Es gibt zwar noch alte Leute, die zu berichten wissen,
dass in
ihrer
Jugend ein alter
Bauer noch mit dem langen Zwilchrock und dem Nebelspalter in
die Kirche gegangen sei. Die Frauen trugen einstmals kleine Spitzen-Hauben
mit breiten Bändern und einen kurzen Kittel, bis auf die
Hüfte reichend, der im Rückenteil nach unten spitz
auslief; sie nannten ihn den Schnäwelesmutzen. Den Halsausschnitt
deckte ein Dreiecktuch aus Seide. Die Männer gingen in starken,
hirschledernen Kniehosen, langen Strümpfen, scharlachroten
Westen, langen blauen Tuch- oder schwarzen Samtröcken mit
stehenden Kragen und dreieckigen Hüten. Diese bäuerliche
Mannstracht beherrschte das ganze Murgtal wie die Rheingegend.
Es war die übliche Bauernkleidung überhaupt. Sie ist
längst völlig abgelegt worden. Am längsten wird
sich, vorab für die Holzmacher, die Hirschlederne erhalten
haben, ihrer Haltbarkeit wegen. Fasnachtsbrauchtum wurde kaum mehr überliefert. In Horden
brannte man noch Scheibenfeuer ab um die Jahrhundertwende als
einziger Gemeinde im Murgtal. Es geschah drei Wochen vor Fasnacht.
Der Scheibenberg in Horden lässt, wie andernorts auch (in
Baden-Baden die steile Scheibenstraße), auf lange Überlieferung
dieses Frühlingsbrauches schließen. Es wurde in Horden
in den drei Wochen vor Fasnacht wöchentlich dreimal Scheiben
geschlagen, und zwar war es zuletzt ein Vorrecht der Rekruten,
dem inneren Sinn nach das alte Recht der mannbaren Jugend fortsetzend.
|
[S. 37] In vielen Orten des Murgtales, aus
Korden ist es uns besonders bekannt, wurden am 1. Mai die Brunnen
bekränzt.
Auch den Mädchen wurden Maien gestellt oder geschenkt, dagegen
den Missliebigen Sägemehl vors Haus gestreut.
Als man noch im Winter am Spinnrad saß, war das „Stubengehen" im
Brauch, und vor Weihnachten die Zehrnacht oder Sperrnacht, wo
die Nacht hindurch gesponnen, gut gegessen und getrunken, gesungen
und erzählt wurde. Da bekamen die Sagen ringsum ihr eigenes
Leben, die von der Teufelsmühle bei Kaltenbronn, die vom
Grafen Eberstein, vom Rockertweible, vom wütigen Heer; denn
die Landschaft ist ungemein reich an Sagen, die von der Wildheit
und Enge des Murgtales im oberen Lauf, von der Waldeinsamkeit
in Felsen und Schluchten, von den verlassenen, heimlichen Wegen über
die Höhen oder durch dunklen Tann, dem Toben der Wildwasser
ihre meistens grausigen und schwermütigen Geschehnisse und
Gesichter nährten. In der Christnacht banden manche Bauern
die Obstbäume fest zu ihrem Segen. Die Frauen stellten das
weit verbreitete Zwiebelorakel auf: Salz wird in zwölf Zwiebelschalen
einer Frucht gestreut, und je nach dem Feuchtigkeitsgrad des
Salzes soll das Wetter in dem Monat werden, für den eine
Schale bestimmt war.
Wo ein Bienenvater starb, rüttelte man am Bienenstand.
Wo die Hausmutter die Augen für immer schloss, wurde an
die Essigflasche gerührt. Diese Sitten ruhen noch
| [S. 38] heute, heimlicher als je geübt, im altbäuerlichen
Volk und sind nicht nur im Murgtal verbreitet, sondern auch in
der
Rheinebene draußen, im Oos- wie im Albtal, ja, örtlich
abgewandelt, im ganzen Reich, finden sie eigentlich ihre Übung
und ihre tiefe Wurzel im naturhaften Glauben unserer Frühzeit.
Eine Weisheit steckt stets darinnen, bisweilen auch die ewig
unabänderliche Furcht des Menschen vor der Macht des Todes.
Um die Winterwende zieht der Pelznickel durch die Täler
und Orte mit seinem Geleit, und danach, hinter dem Christfest
her, wandern die singenden und heischenden drei Könige.
Zum Pelznickel wird auch bisweilen Pelzemärtel gesagt.
Eine merkwürdige neuzeitliche Sagenbildung bewegt sich
um den Tunnel der Murgtalbahn bei Forbach. Dort geistert ein
Lehrer, der in die Felsen geriet und verunglückte. Nachts
schreckt er als schwarzer Mann die Pferde, die mit Langholz das
Tal herabfahren. Bisweilen fällt auch auf die Menschen,
die in der Dunkelheit durch den Tunnel gehen, Sand, von seiner
gespenstischen Hand gestreut.
Aus dem Mund eines alten „Kördemers" stammt
die Schatzsage: „Ame Krizweg nachts am Zwölfe hen
se emol welle christofle. Se hen en Kreis zöge un sin ni
gstanne. Uf eimol isch „de Gott will is b'hüte" komme
miteme Mühlstei ame Näzfade un hetenen üwerm Kopf
rumglunkere losse. Wer üwer de Kreis nus isch, het Fang
kriegt, wer's aber e Stund usghalte het im Kreis, het e ganze
Hufe Geld kriegt."
Aus Hermann Eris Busse: Der Ufgau. Streifzug durch Landschaft
und Volkstum. Badische Heimat 1937 S. 33 - 38 |
 Die Industrie hat dem Murgtal und auch den Ortschaften, die
in die Hänge und Tälchen abseits hineingeborgen sind,
fremden Zuzug gebracht. Das hat wie überall dem Volkstum
mehr genommen als gegeben, das ist nie und nirgends aufzuhalten.
Die Industrie hat dem Murgtal und auch den Ortschaften, die
in die Hänge und Tälchen abseits hineingeborgen sind,
fremden Zuzug gebracht. Das hat wie überall dem Volkstum
mehr genommen als gegeben, das ist nie und nirgends aufzuhalten.