|
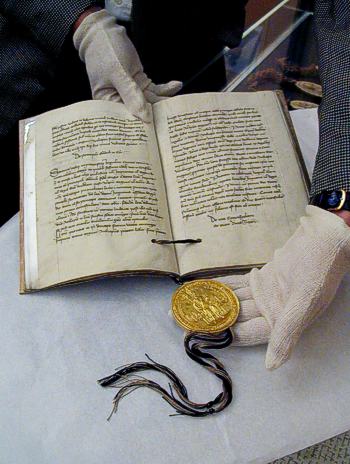 Die Goldene Bulle von 1356 war das wichtigste der „Grundgesetze“ des
Heiligen Römischen Reiches und regelte die Modalitäten
der Wahl und der Krönung der römisch-deutschen Könige
durch die Kurfürsten bis zum Ende des Alten Reiches 1806. Die Goldene Bulle von 1356 war das wichtigste der „Grundgesetze“ des
Heiligen Römischen Reiches und regelte die Modalitäten
der Wahl und der Krönung der römisch-deutschen Könige
durch die Kurfürsten bis zum Ende des Alten Reiches 1806.
Gemäß der mittelalterlichen Privilegientradition
wurde dieses Gesetz als Urkunde für die sieben Kurfürsten
ausgestellt. Der Name ging von dem großen Goldsiegel (Goldblech,
mit Wachs gefüllt), mit dem die Ausfertigungen besiegelt
wurden, auf die ganze Urkunde über. Nannte Kaiser Karl IV.
sie noch „unser keiserliches rechtbuch“, setzte sich
unter König Ruprecht von der Pfalz (1400 – 1410) der
Name „Goldene Bulle“ durch. Die Urkunde wurde in
sieben Exemplaren, für jeden der Kurfürsten eine, ausgefertigt,
später erhielten die Reichsstädte Nürnberg und
Frankfurt ebenfalls jeweils eine Ausfertigung.
Die ersten 23 Kapitel (Nürnberger Gesetzbuch) wurden in
Nürnberg erarbeitet und am 10. Januar 1356 auf dem Nürnberger
Hoftag verkündet, die Kapitel 24 bis 31 (Metzer Gesetzbuch)
am 25. Dezember 1356 in Metz. Formal ist die Urkunde ein kaiserlicher
Rechts-Erlass („de imperialis potestas plenitudine“ – aus
der Fülle kaiserlicher Macht), ihr voraus gingen aber eingehende
Beratungen mit den Fürsten.
Die beiden Gesetzbücher sind in folgende Kapitel aufgegliedert:
Das Nürnberger Gesetzbuch:
1. Zusammensetzung des Geleits der Kurfürsten
2. Die Wahl des römischen Königs
3. Rang und Sitzordnung der drei Erzbischöfe von Mainz,
Trier und Köln
4. Rang und Sitzordnung der übrigen Kurfürsten
5. Von den Rechten des Pfalzgrafen bei Rhein und des Herzogs
von Sachsen bei Vakanz des Reichs
6. Vom Rang der Kurfürsten im Vergleich zu den gemeinen
Fürsten
7. Von der Nachfolge in den Kurfürstentümern
8. Von den Freiheiten des Königs von Böhmen und seiner
Leute
9. Von Silber, Gold und anderen Bodenschätzen in Böhmen
10. Vom Münzrecht des Königs von Böhmen
11. Von den Freiheiten der Kurfürsten
12. Vom Versammlungsrecht der Kurfürsten
13. Von der Widerrufung der Freiheiten
14. Von denen, die ihre Lehengüter unberechtigt aufgeben
15. Über Verschwörer
16. Von den Pfahlbürgern
17. Über die Absage (Fehde)
18. Über die Wahlausschreiben
19. Mandat der Kurfürsten für zur Königswahl bevollmächtigte
Gesandte
20. Von den Gemeinsamkeiten der Kurfürsten und ihren Rechten
21. Von der Ordnung des Aufzugs der Erzbischöfe
22. Von der Ordnung des Aufzugs der weltlichen Kurfürsten
und vom Tragen der Reichsinsignien
23. Von den Segenshandlungen der Erzbischöfe in Anwesenheit
des Kaisers
Metzer Gesetze:
24. (Majestätsrecht der Kurfürsten)
25. (Erbfolge im Kurfürstentum)
26. (Ankunft der Kurfürsten bei Hoftagen)
27. Über die Ämter der Kurfürsten bei feierlichen
Hoftagen
28. (Tischordnung für Kaiser, Kaiserin und Kurfürsten)
29. (Wahl- und Krönungsorte des deutschen Königs)
30. Über den Empfang der Lehen der Kurfürsten
31. (Unterrichtung in der lateinischen, italienischen und slawischen
Sprache)
Die Urkunde wurde in lateinischer Sprache verfasst, deutsche Übersetzungen
erschienen bereits im 15. Jahrhundert, waren aber bis zum Ende
des Alten Reiches nur Behelfsmittel zum Verständnis.
 Die Goldene
Bulle bestätigt im Wesentlichen bereits bestehendes
Recht und verkündet es als kaiserliches Gesetz. Für
die Kurpfalz und ihren damals regierenden Pfalzgrafen Ruprecht
I. bedeutet das zunächst die Sicherung der alleinigen Kurwürde
und den Ausschluss aller bayerischen Ansprüche. Die Goldene
Bulle bestätigt im Wesentlichen bereits bestehendes
Recht und verkündet es als kaiserliches Gesetz. Für
die Kurpfalz und ihren damals regierenden Pfalzgrafen Ruprecht
I. bedeutet das zunächst die Sicherung der alleinigen Kurwürde
und den Ausschluss aller bayerischen Ansprüche.
Die weiteren Bestimmungen sind:
- Festlegung der Reihenfolge der Kurstimmen mit Trier, Köln,
Böhmen, Pfalz, Sachsen, Brandenburg und Mainz. Die Mainzer
Stimme war die letzte, weil dem Mainzer Erzbischof die Abfrage
der Stimmen oblag – erst danach gab er selbst seine Stimme
ab.
- Dem Kurfürst von der Pfalz steht das Reichsvikariat am
Rhein, in Schwaben und inden Ländern fränkischen
Rechts zu.
- Die Gerichtsbarkeit des Kurfürsten von der Pfalz über
den König wird genau festgelegt.
- Die Erbfolge in den Kurfüstentümern wird nach dem
Erstgeburtsrecht festgelegt, Fragen der der Ersatz-Erbfolge
und der Vormundschaft werden geregelt
- Die Mündigkeit zur Kur wird auf 18 Jahre festgesetzt.
- Die Kurfürsten erhalten das „Privilegium de non appellando“ und
damit Befreiung der Kurfürstentümer von der kaiserlichen
Appellationsgerichtsbarkeit.
- Das Krönungszeremoniells des Königs und Kaisers und
die Ausübung der Erzämter werden verbindlich beschrieben.
Danach ist der pfälzische Kurfürst Erztruchsess und
reicht dem neugewählten Kaiser vier silberne Schüsseln
(jede im Gewicht von 3 Mark Silber) mit Speisen.
In der Reihenfolge der Kurstimmen stand die Pfalz zwar hinter
Böhmen (dem dieser Rang wegen seiner königlichen Würde
zustand), da die böhmische Stimme aber oft ausfiel, war die Pfalz
faktisch der erste der weltlichen Wähler.
Bilder: Präsentation des Stuttgarter Exemplars der Goldenen
Bulle (oben)
Der Pfalzgraf
bei Rhein aus dem Mainzer Kurfürstenzyklus (unten). Epoxidharz-Abguss
Beide Abbildungen aus dem Zusammenhang der Ausstellung "Mittelalter
- Schloss Heidelberg und die Pfalzgrafschaft bei Rhein bis zur
Reformationszeit" im
Heidelberger Schloss (2000)
|