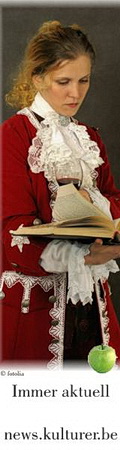Projekt kulturer.be
Nachrichten & Notizen aus dem Kulturerbe
17.1.18
Archäologische Grabungen in Baden-Württemberg
Grabungen 2017 im Regierungsbezirk Tübingen (2)
(rps) 2017 wurden in Baden-Württemberg über 200 Sondagen und Ausgrabungen durchgeführt. Ein beträchtlicher Teil davon erstmals unter Einbeziehung von Grabungsfirmen, wobei kommerzielle Firmen ausschließlich bei planbaren Rettungsgrabungen eingesetzt wurden, also bei Baumaßnahmen im Bereich bekannter archäologischer Fundstätten. Dadurch konnte sich das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) Baden-Württemberg auf die Durchführung von methodisch besonders anspruchsvollen Schwerpunkt- und Forschungsgrabungen, aber auch auf kaum planbare Notgrabungen im Zuge archäologischer Zufallsentdeckungen konzentrieren.
Bereits berichtet wurde im ersten Teil über die Grabungen auf der Heuneburg bei Herbertingen-Hundersingen (Landkreis Sigmaringen), über neue Forschungen zur Jungsteinzeit im Oberen Gäu (Landkreis Tübingen), das Alamannische Gräberfeld Mössingen „Zollernstraße“ (Landkreis Tübingen), die Grabungen im Grabungsfeld 2 der Wüstung Brechesdorf (Tübingen-Kilchberg, Landkreis Tübingen) und in der Obere Gasse 27-29 in Rottenburg, (Landkreis Tübingen)
Im Folgenden weitere herausragende Grabungen im Kurzporträt.
Hechingen-Stein (Zollernalbkreis) - Römische Villa wächst weiter
Zu bemerkenswerten Ergebnissen führte auch im Jahre 2017 die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart und dem örtlichen Förderverein zur Erforschung und Präsentation der römischen villa rustica in Hechingen-Stein (Zollernalbkreis).

 Die Ausgrabung der nordöstlichen Ecke der bekannten Umfassungsmauer des Gutshofes ergab eine bis dahin nicht beobachtete Mehrphasigkeit der Einhegung. Nicht nur der im Eck stehende Turm wurde nachträglich hinzugefügt, sondern die gesamte seitliche Umfassungsmauer ist sekundär. Diese muss zuvor viel weiter östlich verlaufen sein. Wo genau, ist bisher völlig unbekannt. Auch hangaufwärts war die Anlage ursprünglich größer als das heutige Freilichtmuseum. Das belegen neu lokalisierte antike Trümmerstellen. Damit wird immer deutlicher: das Museumsgelände spiegelt trotz seiner immer noch beeindruckenden Ausdehnung lediglich eine späte, räumlich reduzierte Phase des Gutshofes wieder.
Die Ausgrabung der nordöstlichen Ecke der bekannten Umfassungsmauer des Gutshofes ergab eine bis dahin nicht beobachtete Mehrphasigkeit der Einhegung. Nicht nur der im Eck stehende Turm wurde nachträglich hinzugefügt, sondern die gesamte seitliche Umfassungsmauer ist sekundär. Diese muss zuvor viel weiter östlich verlaufen sein. Wo genau, ist bisher völlig unbekannt. Auch hangaufwärts war die Anlage ursprünglich größer als das heutige Freilichtmuseum. Das belegen neu lokalisierte antike Trümmerstellen. Damit wird immer deutlicher: das Museumsgelände spiegelt trotz seiner immer noch beeindruckenden Ausdehnung lediglich eine späte, räumlich reduzierte Phase des Gutshofes wieder.
Neben den Ausgrabungen ging auch der Wiederaufbau des zum Gutshof gehörenden Tempelbezirks weiter. Das Amt erarbeitete hierzu detaillierte Rekonstruktionsvorschläge. Der Wiederaufbau wird nicht nur den Erlebniswert des Freilichtmuseums weiter steigern, sondern den Besuchern auch anschaulich vor Augen führen, dass die römische villa rustica von Hechingen-Stein mehr war als ein großer Bauernhof. Ausdehnung und Architektur des Tempelbezirks sprechen eine deutliche Sprache: der Kultplatz kann nicht allein für die religiösen Bedürfnisse der wenigen Villen-Bewohner gedacht gewesen sein.
Hechingen-Stein. Römische Villa.
Oben: Ehrenamtliche Grabungshelfer bei der Arbeit. Freilegung und Dokumentation des neuen Eckturms mit Mauerfundamenten und Ruinenschutt. Foto: K. Kortüm / Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart
Unten: Rekonstruktionsarbeiten am Tempelbezirk. Die Säulenhalle für Weihgeschenke entsteht. Foto: Th. Schlipf / Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart
Balingen, Wilhelmstraße 35 (Zollernalbkreis)

 Die Wilhelmstraße in Balingen (Zollernalbkreis) verläuft im verfüllten ehemaligen Stadtgraben. Der Neubau Wohnhauses für Menschen mit Behinderung gab im März / April 2017 Anlass zu einer Rettungsgrabung, da innerhalb des ca. 500 m² großen Baufensters Reste der Stadtmauer sowie archäologische Relikte der mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Bebauung zu erwarten waren. Die Rettungsgrabung wurde vom Büro Archäo / IKU Rottenburg durchgeführt.
Die Wilhelmstraße in Balingen (Zollernalbkreis) verläuft im verfüllten ehemaligen Stadtgraben. Der Neubau Wohnhauses für Menschen mit Behinderung gab im März / April 2017 Anlass zu einer Rettungsgrabung, da innerhalb des ca. 500 m² großen Baufensters Reste der Stadtmauer sowie archäologische Relikte der mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Bebauung zu erwarten waren. Die Rettungsgrabung wurde vom Büro Archäo / IKU Rottenburg durchgeführt.
Erwartungsgemäß wurde über die gesamte Länge des Grundstücks im Westen das Fundament der Stadtmauer freigelegt. Zudem fanden sich Keller von Häusern, die im 17./18. Jahrhundert an die Stadtmauer angebaut und beim Stadtbrand 1819 zerstört worden waren. Diese Keller wurden bei der Neubebauung nach dem Stadtbrand in modifizierter Form weiterbenutzt. Ein weiterer Keller an der Ostgrenze des Grundstücks wurde nur randlich erfasst. Hier gefundene Ofenkacheln von außergewöhnlicher Qualität datieren in die Zeit um 1500. Zwischen den Gebäuden fanden sich frühneuzeitliche Kanälchen sowie vier spätmittelalterliche bis frühneuzeitliche Brunnen bzw. Latrinen mit zahlreichem, sehr gut erhaltenem Fundmaterial. Neben Keramikgefäßen konnten hier auch organische Reste geborgen werden, wie z. B. ein Schuh oder ein Korbgeflecht.
Stadtmauerfundament mit daran angebautem frühneuzeitlichem Keller.
Spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Brunnen/Latrine.
Beide Fotos: Archäo/IKU, Rottenburg
Unten: Keramikgefäße aus Brunnen/Latrinen unterschiedlicher Zeitstellung. Foto: Christoph Schwarzer / Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart

BELAVI – Beyond Lake Villages: Ein trinationales Projekt bringt eine neue neolithische Fundlandschaft im Westallgäu ans Licht

 Im Rahmen eines trinationalen Projektes mit Kollegen aus der Schweiz und Österreich wurde seit 2016 die Landschaft zwischen Bodensee, Schussen und der Bayrischen Grenze archäologisch untersucht. Aufgrund der höheren Niederschläge und des kühleren Klimas galt dieser Westallgäuer Raum lange als eine Landschaft, die in der Jungsteinzeit nicht besiedelt wurde. Während des Projektes konnten hier jedoch über zwei Dutzend neue Fundstellen erfasst und datiert werden.
Im Rahmen eines trinationalen Projektes mit Kollegen aus der Schweiz und Österreich wurde seit 2016 die Landschaft zwischen Bodensee, Schussen und der Bayrischen Grenze archäologisch untersucht. Aufgrund der höheren Niederschläge und des kühleren Klimas galt dieser Westallgäuer Raum lange als eine Landschaft, die in der Jungsteinzeit nicht besiedelt wurde. Während des Projektes konnten hier jedoch über zwei Dutzend neue Fundstellen erfasst und datiert werden.
Die Zusammenarbeit zwischen Experten verschiedener Disziplinen hat zum Nachweis von Seeufersiedlungen, Moorsiedlungen und Höhensiedlungen geführt, von denen viele in die Zeit um 3800-3700 v. Chr. datieren. In die gleiche Zeit gehören auch viele der Pfahlbauten am besser erforschten Bodensee und die Moorsiedlungen in Oberschwaben.
Oben: Nachtschicht im Grabungsschnitt am Hirenseemoos. Foto: UWARC
Unten: Mit Lehm und Steinen befestigte Feuerstelle aus der Zeit um 3700 v. Chr. – direkt unter der heutigen Grasnarbe in Bodnegg aufgedeckt. Foto: Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart
Zusätzlich kann mit Hilfe von Bohrungen in mehreren kleinen Seen über die Pollenanalyse die Landschaftsveränderung in diesem Raum über die letzten 6500 Jahre rekonstruiert werden. Der Mensch war dabei ein ebenso wichtiger Faktor wie das Klima. Sicher spielte auch die Verkehrsverbindung bei der Besiedlung eine Rolle. Über die Flüsse Argen, Eschach und Aitrach kann die europäische Wasserscheide Rhein/Donau mit einer kurzen Landpassage überwunden werden. Dass sich schon in der Jungsteinzeit Waren, Ideen und Personen über weite Distanzen bewegt haben, zeigen die Funde von norditalienischem Feuerstein oder österreichischem Kupfer in den Feuchtbodensiedlungen.
Bad Buchau „Neuweiher II“


 Das geplante Neubaugebiet Bad Buchau „Neuweiher II“ befindet sich im ehemaligen Uferbereich der Insel Buchau zum Federsee hin. Obwohl das eigentliche Seebecken durch Entwässerungen schon längst trocken gefallen ist, haben sich hier im Hangbereich noch feucht erhaltene Schichten über wasserundurchlässigen Beckentonen erhalten. Diese enthalten zahlreiche Zeugnisse aus über 10.000 Jahren menschlicher Nutzung des Federseeufers. Zu den ältesten Resten gehören Rentierknochen mit Schnittspuren, ein Gefäß aus der Zeit der ersten Bauern (ca. 5200 v. Chr.) sowie hunderte von Netzsenkern (zum Fischen recycelte Keramikscherben) aus der Jungsteinzeit. Auch die Bronze-, Eisen- und Römerzeit sowie das Frühmittelalter sind durch Fundmaterial vertreten.
Das geplante Neubaugebiet Bad Buchau „Neuweiher II“ befindet sich im ehemaligen Uferbereich der Insel Buchau zum Federsee hin. Obwohl das eigentliche Seebecken durch Entwässerungen schon längst trocken gefallen ist, haben sich hier im Hangbereich noch feucht erhaltene Schichten über wasserundurchlässigen Beckentonen erhalten. Diese enthalten zahlreiche Zeugnisse aus über 10.000 Jahren menschlicher Nutzung des Federseeufers. Zu den ältesten Resten gehören Rentierknochen mit Schnittspuren, ein Gefäß aus der Zeit der ersten Bauern (ca. 5200 v. Chr.) sowie hunderte von Netzsenkern (zum Fischen recycelte Keramikscherben) aus der Jungsteinzeit. Auch die Bronze-, Eisen- und Römerzeit sowie das Frühmittelalter sind durch Fundmaterial vertreten.
Oben: Drohnenaufnahme der Grabungsschnitte mit Blick über das Federseebecken (oben). Die bereits ausgegrabenen Schnitte sind hangabwärts schon wieder mit Wasser gefüllt. Foto: Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart
Mitte: Verziertes Keramikfragment aus der Jungsteinzeit, mit zwei Kerben versehen als Netzsenker recycelt. Foto: Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart
Unten: Holzreste während der Ausgrabung. Die Oberfläche ist schon stark verwittert, eine menschliche Bearbeitung ist schwierig zu erkennen. Foto: Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart
Besonders bemerkenswerte Funde sind sicherlich die erhaltenen Holzobjekte, zu denen Paddel, Einbaumfragmente, weitere Werkzeugteile und bearbeitete Bauhölzer gehören. Obwohl hier keine eigentlichen Siedlungsreste angetroffen wurden, spiegeln die gefundenen verlorenen oder weggeworfenen Gegenstände die kontinuierliche Nutzung der Insel Bad Buchau und des Ufers über tausende von Jahren wider.
Zusätzlich ermöglichen die natürlichen Pflanzenreste und der Verlauf der verschiedenen Sand-, Torf- und Muddeschichten die Rekonstruktion der (Verlandungs-) Geschichte dieses Uferabschnittes. Die Rettungsgrabung wird 2018 fortgesetzt.
| im Detail: | |
| siehe auch: |
Startseite | Service | zur
ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2018
© Texte der Veranstalter, ohne Gewähr