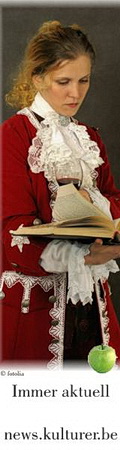Projekt kulturer.be
Nachrichten & Notizen aus dem Kulturerbe
22.1.18
Archäologische Grabungen in Baden-Württemberg
Grabungen 2017 im Regierungsbezirk Stuttgart (2)
(rps) 2017 wurden in Baden-Württemberg über 200 Sondagen und Ausgrabungen durchgeführt. Ein beträchtlicher Teil davon erstmals unter Einbeziehung von Grabungsfirmen, wobei kommerzielle Firmen ausschließlich bei planbaren Rettungsgrabungen eingesetzt wurden, also bei Baumaßnahmen im Bereich bekannter archäologischer Fundstätten. Dadurch konnte sich das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) Baden-Württemberg auf die Durchführung von methodisch besonders anspruchsvollen Schwerpunkt- und Forschungsgrabungen, aber auch auf kaum planbare Notgrabungen im Zuge archäologischer Zufallsentdeckungen konzentrieren.
Im Folgenden einige herausragende Grabungen im Kurzporträt.
Esslingen Martinstraße - Ehnisgasse (Landkreis Esslingen)

 In der dicht bebauten Altstadt von Esslingen am Neckar mit seiner gut erhaltenen mittelalterlichen Bausubstanz erlauben archäologische Ausgrabungen meist nur sehr kleinräumige Einblicke. Durch die geplante Neubebauung des Parkplatzes eines Einkaufszentrums wurden von März bis Juli 2017 eine über 5.000 m² großen Fläche innerhalb der Pliensauvorstadt untersucht. Im Fokus standen die Parzellen der Ehnisgasse, deren Bebauung noch im gegenwärtigen Bestand auf das späte 13. Jahrhundert zurückreicht. Trotz großflächiger moderner Störungen durch die Gebäude der Esslinger Brauereigesellschaft konnten Brunnen und Latrinen sowie weitere Hinweise auf die wirtschaftliche Nutzung der Hinterhöfe in der Neuzeit erfasst werden. Auch ließ sich die Entwicklung der erhaltenen Keller der Straßenrandbenutzung nachzeichnen.
In der dicht bebauten Altstadt von Esslingen am Neckar mit seiner gut erhaltenen mittelalterlichen Bausubstanz erlauben archäologische Ausgrabungen meist nur sehr kleinräumige Einblicke. Durch die geplante Neubebauung des Parkplatzes eines Einkaufszentrums wurden von März bis Juli 2017 eine über 5.000 m² großen Fläche innerhalb der Pliensauvorstadt untersucht. Im Fokus standen die Parzellen der Ehnisgasse, deren Bebauung noch im gegenwärtigen Bestand auf das späte 13. Jahrhundert zurückreicht. Trotz großflächiger moderner Störungen durch die Gebäude der Esslinger Brauereigesellschaft konnten Brunnen und Latrinen sowie weitere Hinweise auf die wirtschaftliche Nutzung der Hinterhöfe in der Neuzeit erfasst werden. Auch ließ sich die Entwicklung der erhaltenen Keller der Straßenrandbenutzung nachzeichnen.
Keller der ehemaligen Ehnisgasse 10. Der Boden weist Löcher kleiner Pfosten und Gruben auf, welche auf ein im Boden fest verankertes Arbeitsgerät hindeuteten. Foto: Archäologie-Zentrum
Webgewicht aus Ton mit mittiger Durchlochung im Grubenhauses des 11./12. Jahrhunderts. Foto: Archäologie-Zentrum
Teils mächtige Planierschichten sprechen für eine Anpassung der Geländeoberfläche. Völlig überraschend traf man in den ungestörten Bereichen der Hinterhöfe unterhalb der Schichten auf ältere Baustrukturen. Hervorzuheben sind neben spätmittelalterlichen Erdkellern, ein fast 4 m x 3 m großes Grubenhaus des 11./12. Jahrhunderts. Damit liegt ein Beleg vor, der eine weitaus großflächigere frühe Aufsiedlung der Pliensauvorstadt nahelegt, als bislang vermutet. Aus dem Grubenhaus stammen einige Webgewichte, die eine Nutzung des Gebäudes als Webhütte wahrscheinlich machen.
Kirchheim unter Teck, „Alleen-/Jahnstraße“ (Landkreis Esslingen)
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Lauterterrassen“ der Stadt Kirchheim unter Teck (Kr. Esslingen) zur Bebauung eines größtenteils brach liegenden Geländes unmittelbar an der Lauter mit Luxusappartements bedingte eine archäologische Voruntersuchung des Geländes, die durch die Firma Archäologie-Zentrum GmbH durchgeführt. Seine Lage direkt gegenüber des Kirchheimer Schlosses auf der südwestlichen Ecke der Altstadt schließt auch das Kulturdenkmal des randlich an der Stadt entlanggeführten Mühlkanals und die durch diesen Wirtschaftskanal geprägte Bebauung ein.

 Zu überprüfen war auch, ob sich die auf der anderen Lauterseite in zahlreichen Fundstellen nachgewiesene vorstädtische früh- bis hochmittelalterliche Siedlung noch in diesem Areal fortsetzte. Die Sondagen bestätigten hier die Begrenzung des vorstädtischen Siedlungsbereichs durch den Verlauf der Lauter. Der nachgewiesene gut erhaltene Mühlkanal und die Reste der Bebauung des 18. Jahrhunderts am Mühlkanal bedingten eine ab Oktober anschließende Grabung. Dabei wurde das Gelände nicht in Gänze ergraben, sondern nur schwerpunktmäßig an den jeweiligen Fragestellungen orientierte Areale standen im Mittelpunkt der Untersuchung. Die Keller der zwei im Süden und Norden noch stehenden Gebäude wurden durch eine bauforscherische Dokumentation in die Untersuchung mit einbezogen und das unmittelbare Umfeld untersucht, um ältere Baustrukturen aufnehmen zu können.
Zu überprüfen war auch, ob sich die auf der anderen Lauterseite in zahlreichen Fundstellen nachgewiesene vorstädtische früh- bis hochmittelalterliche Siedlung noch in diesem Areal fortsetzte. Die Sondagen bestätigten hier die Begrenzung des vorstädtischen Siedlungsbereichs durch den Verlauf der Lauter. Der nachgewiesene gut erhaltene Mühlkanal und die Reste der Bebauung des 18. Jahrhunderts am Mühlkanal bedingten eine ab Oktober anschließende Grabung. Dabei wurde das Gelände nicht in Gänze ergraben, sondern nur schwerpunktmäßig an den jeweiligen Fragestellungen orientierte Areale standen im Mittelpunkt der Untersuchung. Die Keller der zwei im Süden und Norden noch stehenden Gebäude wurden durch eine bauforscherische Dokumentation in die Untersuchung mit einbezogen und das unmittelbare Umfeld untersucht, um ältere Baustrukturen aufnehmen zu können.
Unten: Detail der östlichen Mühlkanalwange mit unter der Mauer eingebautem Eichenbalken und Pfosten. Foto: Archäologie-Zentrum GmbH
Da sich der Abbruch des nördlichen Gebäudes verzögert hat, konnte die Untersuchung hier noch nicht abgeschlossen werden und wird sich noch ins Jahr 2018 hin ziehen. Im Umfeld des südlichen Gebäudes konnten Strukturen festgestellt werden, die auf jeden Fall älter sind als die moderne Nutzung und handwerkliche Tätigkeiten belegen, die sich im Moment noch der Interpretation entziehen. Im Bereich des Mühlkanals konzentrierte sich die Untersuchung darauf, verschiedene Bauphasen des erst im späteren 20. Jahrhunderts völlig aufgegebenen Kanals zu dokumentieren und zu datieren, da sich die Frage stellte, ob die Darstellung des Bereichs in den Kieser’schen Forstkarten der 1680er Jahre, in der die im weiteren Bereich verorteten Mühlen als Bachmühlen ohne Existenz eines Mühlkanals dargestellt werden, doch den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen könnte. Durch die archäologische Untersuchung konnte das eindeutig widerlegt werden, da die Konstruktion der östlichen Kanalwange eichene Hölzer enthielt, die dendrochronologisch auf die Jahre um 1523 datiert werden können.
Die westliche Kanalwange dagegen stellt wohl eine jüngere Ausbauphase dar, die aus gut erhaltenen Großsteinquadern besteht, die allerdings an vielen Stellen durch eine frühe Gussbetonkonstruktion ergänzt war. Eingetieft war der Kanal in großflächige Aufplanierungen aus Kies, der Keramik des 15. und 16. Jahrhunderts enthielt und möglicherweise in Zusammenhang mit dem festungsmäßigen Ausbau der Kirchheimer Stadtbefestigung samt Schloss in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts zu bringen ist.
Diese Grabung zeigt, dass auch die oft stiefmütterlich behandelte Archäologie neuzeitlicher Strukturen im Stande ist, spannende und wichtige Ergebnisse zur Siedlungsentwicklung und Geschichte zu liefern.
Felsdach Kohlhau-Abri (Landkreis Heidenheim)
In den Sommermonaten 2017 wurden die archäologischen Ausgrabungen in dem Felsdach Kohlhau-Abri fortgesetzt. Das Kohlhau-Abri liegt im sogenannten Tiefen Tälchen an der Grenze der Gemarkungen von Niederstotzingen-Stetten und Bissingen (Landkreis Heidenheim).
 Die Fundstelle erbrachte eine differenzierte Schichtenfolge: die ältesten Funde gehören in die Spätphase der Jüngeren Altsteinzeit und können auf den Zeitbereich zwischen 16.000 und 15.000 Jahren datiert werden. Die Funde deuten darauf hin, dass die Jäger und Sammler des Magdalénien an dem Felsdach eine Rast während eines Jagdzuges einlegten. Knochen der Jagdbeute, wie Rentier und Wildpferd sowie einige Steinartefakte, wurden geborgen. Darüber folgt eine Fundschicht, die in die Mittelsteinzeit um etwa 7.500 v. Chr. zu stellen ist. Auch hier fanden sich Steinwerkzeuge und Knochen der Jagdbeute im Bereich einer Feuerstelle. Darüber folgt eine jungsteinzeitliche Fundschicht, die in die Zeit zwischen 4.500 und 5.000 v. Chr. zu datieren ist. In dieser Schicht fanden sich neben Knochen und Steinwerkzeugen auch Scherben von Tongefässen.
Die Fundstelle erbrachte eine differenzierte Schichtenfolge: die ältesten Funde gehören in die Spätphase der Jüngeren Altsteinzeit und können auf den Zeitbereich zwischen 16.000 und 15.000 Jahren datiert werden. Die Funde deuten darauf hin, dass die Jäger und Sammler des Magdalénien an dem Felsdach eine Rast während eines Jagdzuges einlegten. Knochen der Jagdbeute, wie Rentier und Wildpferd sowie einige Steinartefakte, wurden geborgen. Darüber folgt eine Fundschicht, die in die Mittelsteinzeit um etwa 7.500 v. Chr. zu stellen ist. Auch hier fanden sich Steinwerkzeuge und Knochen der Jagdbeute im Bereich einer Feuerstelle. Darüber folgt eine jungsteinzeitliche Fundschicht, die in die Zeit zwischen 4.500 und 5.000 v. Chr. zu datieren ist. In dieser Schicht fanden sich neben Knochen und Steinwerkzeugen auch Scherben von Tongefässen.
Bild: Ausgrabungsarbeiten im Kohlhau-Abri. Foto: Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart
Dies zeigt, dass auch während der Jungsteinzeit, in der die Menschen als sesshafte Ackerbauern und Viehzüchter lebten, Felsdächer wie das Kohlhau-Abri zu kurzfristigen Aufenthalten genutzt wurden. Eine Fundschicht mit bronzezeitlichen Scherben schließt die Schichtenfolge ab.
Bad Rappenau-Babstadt (Landkreis Heibronn) - Beste Wohnlage!

 Am nordöstlichen Ortsrand von Bad Rappenau-Babstadt im Gewann „Waldäcker“ soll ein großes Wohngebiet für Familien entstehen. Das an einem Südhang gelegene Baugebiet hatte sich jedoch schon seit Jahrtausenden als Wohnplatz großer Beliebtheit erfreut: im 6. Jahrtausend v. Chr. standen hier große Holzhäuser der ersten jungsteinzeitlichen Bauern. Um 600 v. Chr. haben frühe Kelten ihre Spuren hinterlassen. Im 2. Jahrhundert n. Chr. wurde – unweit der römischen Fernstraße von Wimpfen an den Rhein – ein großer römischer Gutshof errichtet.
Am nordöstlichen Ortsrand von Bad Rappenau-Babstadt im Gewann „Waldäcker“ soll ein großes Wohngebiet für Familien entstehen. Das an einem Südhang gelegene Baugebiet hatte sich jedoch schon seit Jahrtausenden als Wohnplatz großer Beliebtheit erfreut: im 6. Jahrtausend v. Chr. standen hier große Holzhäuser der ersten jungsteinzeitlichen Bauern. Um 600 v. Chr. haben frühe Kelten ihre Spuren hinterlassen. Im 2. Jahrhundert n. Chr. wurde – unweit der römischen Fernstraße von Wimpfen an den Rhein – ein großer römischer Gutshof errichtet.
Das Baugebiet „Waldäcker“ mit Babstadt im Hintergrund. Die Grabungsflächen konzentrieren sich zunächst auf die Erschließungsstraßen. Foto: fodilus Gmbh
Unten:
Täuschend echt: Der Denar des Kaisers Severus Alexander entpuppte sich bei genauem Hinsehen als antikes Falschgeld. Foto: Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart
Vor gut 20 Jahren haben erste Ausgrabungen eines Streifens im mittleren Bereich des Baugebiets Teile der römischen Anlage ans Licht gebracht. Ein steinernes Wohngebäude, ein Brunnen, ein Kalkbrennofen und ein mehr als 600 m2 messender Speicherbau wurden untersucht. Sie bezeugen die wirtschaftliche Potenz des Gutsherrn. Der Hof bestand bis um die Mitte des 3. Jahrhunderts. Auf den Abzug der Römer folgten frühe germanische Siedler, die in überraschend großer Zahl Keramik und andere Alltagsobjekte hinterließen. Im Westen des Baugebiets schließlich wurde eine Siedlung des späten Mittelalters angeschnitten, die sich durch Keller und Töpferöfen zu erkennen gibt.
Diese ungewöhnlich vielschichtige Besiedlung wird seit Ende August 2017 durch die Firma fodilus GmbH in einer großen Flächengrabung untersucht. Dabei zeigte sich, dass die römischen Baustrukturen fast bis zum Fuß des Hanges reichen. Erste spannende Ergebnisse sind ein sehr gut erhaltener jungsteinzeitlicher Gebäudegrundriss, der Nachweis römischer Holzarchitektur und Hinweise auf eine zum Gutshof gehörende Badeanlage.
Stuttgart-Bad Cannstatt - Urnenfelderkultur unter dem Schulhof
 Im Vorfeld einer Baumaßnahme in Stuttgart-Bad Cannstatt konnten durch eine Sondierung zwei Bestattungen der Urnenfelderkultur erfasst werden. Der Fundplatz befindet sich unweit des bis ins 8./9. Jh. n. Chr. zurückreichenden Friedhofs an der Uffkirche. Im Zuge der anschließenden Rettungsgrabung – durchgeführt von der Grabungsfirma ArchaeoConnect aus Tübingen – konnten neben neuzeitlichen Befunden weitere Urnengräber sowie mehrere Siedlungsbefunde samt Fundmaterial der Spätbronzezeit dokumentiert und geborgen werden.
Im Vorfeld einer Baumaßnahme in Stuttgart-Bad Cannstatt konnten durch eine Sondierung zwei Bestattungen der Urnenfelderkultur erfasst werden. Der Fundplatz befindet sich unweit des bis ins 8./9. Jh. n. Chr. zurückreichenden Friedhofs an der Uffkirche. Im Zuge der anschließenden Rettungsgrabung – durchgeführt von der Grabungsfirma ArchaeoConnect aus Tübingen – konnten neben neuzeitlichen Befunden weitere Urnengräber sowie mehrere Siedlungsbefunde samt Fundmaterial der Spätbronzezeit dokumentiert und geborgen werden.
Stuttgart-Bad Cannstatt: Ansicht eines der Urnengräber im Planum. Foto: ArchaeoConnect GmbH
Die neun Gräber, die nur anhand der mit Leichenbrand gefüllten Urnen erkennbar waren, lagen 4 bis 5 Meter voneinander entfernt. Die Größe der Urnengefäße variiert stark und ist mit einem max. Durchmesser von bis zu 60 cm beachtlich. Diese wurden im Block geborgen und werden im Anschluss an die archäologische Maßnahme in der Restaurierungswerkstatt des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart geröntgt und schichtweise ausgenommen. Danach erfolgt die anthropologische Begutachtung der Leichenbrände, um näheres über die Bestatteten und ihre Lebensumstände zu erfahren.
Neben den Bestattungen konnten auch spätbronzezeitliche Siedlungsreste, darunter Gruben mit Tierknochen und Keramik, erfasst werden. Vermutlich handelt es sich hierbei um die zum Bestattungsplatz gehörige Siedlung.
| im Detail: | |
| siehe auch: |
Startseite | Service | zur
ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2018
© Texte der Veranstalter, ohne Gewähr