|
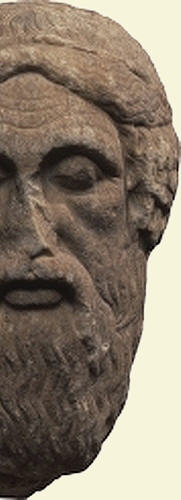 Die grosse Troia-Ausstellung 2001/02 mit ihren rund 850'000 Besuchern
und ihrem enormen Echo in den Medien hat auch den Dichter, dem
wir die Troia-Geschichte verdanken, wieder stärker ins Bewusstsein
gerückt: Homer. Mit seiner Ilias und der ihm zugeschriebenen Odyssee
hat dieser griechische Sängerdichter der zweiten Hälfte des 8.
Jahrhunderts v. Chr. die europäische Literatur begründet. Damit
ist er zu einem der Gründerväter der europäischen Kultur geworden.
Die grosse Troia-Ausstellung 2001/02 mit ihren rund 850'000 Besuchern
und ihrem enormen Echo in den Medien hat auch den Dichter, dem
wir die Troia-Geschichte verdanken, wieder stärker ins Bewusstsein
gerückt: Homer. Mit seiner Ilias und der ihm zugeschriebenen Odyssee
hat dieser griechische Sängerdichter der zweiten Hälfte des 8.
Jahrhunderts v. Chr. die europäische Literatur begründet. Damit
ist er zu einem der Gründerväter der europäischen Kultur geworden.
Das
steigende Interesse weiter Kreise an den eigenen Wurzeln in einer
zunehmend multikulturell geprägten Umwelt hat in den letzen Jahren
eine kaum noch überschaubare Menge von Büchern, Filmen, Dramatisierungen
sowie Funk- und Fernsehsendungen zum Thema Homer hervorgebracht.
Der Überblick und die Unterscheidung zwischen Legendarischem bzw.
Fiktivem und Gesichertem ist schwer geworden.
Die Ausstellung "Homer: Der Mythos von Troia in Dichtung
und Kunst" möchte hier Klarheit schaffen. In fünf Sektionen
stellt sie auf ca. 1'000 m2 Ausstellungsfläche zum ersten Mal
(1) Homer in seiner Zeit, (2)
Homer als Endpunkt einer langen Dichtungstradition, (3)
Homers Werke Ilias und Odyssee und schliesslich (4)
deren aussergewöhnliche Wirkungsgeschichte, die bis heute anhält,
auf der Grundlage des neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-Standes
vor. Im Zusammenwirken didaktischer Mittel und von rund 230 Original-Werken
aus den renommiertesten Museen Europas in höchster Qualität von
der Antike bis heute entsteht ein Homer-Bild von grosser Dichte
und Eindringlichkeit, das in seiner Kombination aus intellektueller
und ästhetischer Suggestivkraft dem Besucher bei seinen weiteren
Begegnungen mit Homer als feste Urteilsbasis dienen kann.
Dabei werden hochrangige antike Kunstwerke
(aus der Spätbronzezeit bis in die Zeit Homers und aus jüngeren
Epochen), aber auch spätere Rezeptionsbeispiele (Gemälde und andere
Kunstwerke) von der Renaissance bis in die Gegenwart, zusammen
mit Erläuterungstafeln, Hörproben und Textausschnitten (in Griechisch
und Deutsch) die Ausstellung facettenreich und didaktisch informativ
gliedern.
Die erste Sektion (1) "Homer und seine Zeit"
thematisiert die Person Homers. Was wissen wir heute über den
Dichter? Was für Legenden ranken sich um seine Person? Die sechs
Büsten, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, repräsentieren
alle vier Homer-Typen, in denen die Antike das Aussehen von Homer
- rein fiktiv, aber sehr suggestiv - einzufangen versuchte. Darunter
befinden sich die berühmte Büste aus der Staatlichen Antikensammlung
und Glyptothek München (Kat. Nr. 1) und eine aus den Musei Capitolini
in Rom (Kat. Nr. 2). Vier Münzbilder ergänzen das imaginäre ‚Portrait'
des Dichters.
In Teil zwei dieser Sektion mit dem Titel "Die
Kulturhöhe zur Zeit Homers" versucht die Ausstellung das Umfeld,
den Lebensraum, kurz: die Zeit Homers mit seiner Verwurzelung
in Adelskreisen als höfischer Sänger und die Umbrüche um und nach
800 ("die griechische Renaissance") mithilfe von auserwählten
Kunstwerken und Grabbeigaben aufzuzeigen. Besondere Erwähnung
verdient hier die 111,2 cm hohe geometrische Amphora von um 750
v. Chr. mit der Darstellung einer Bestattung aus dem Antikenmuseum
Basel (Kat. Nr. 19). Geometrische Vasen und eine Reihe herausragender
Objekte aus der anschliessenden orientalisierenden Epoche des
7. Jahrhunderts v. Chr. - dem Beginn der Kolonisation, die Homer
mit seiner Odyssee verarbeitet hat - zeigen den Wandel und die
enorme Ausbreitung an Wert, Wissen und Materialen auf. Der dritte
Teil dieser Sektion "Die Schrift" stellt die Wiederaneignung der
Schrift durch die Griechen mithilfe der Übernahme und Verbesserung
der phönizischen Alphabetschrift in den Vordergrund, weil heute
angenommen wird, dass Homer als erster Dichter zwar noch in der
alten mündlichen Tradition wurzelte, aber seine Epen bereits schriftlich
fixiert hat - was bei einer Länge von rund 16'000 Versen der Ilias
und rund 12'000 der Odyssee gar nicht anders machbar gewesen wäre.
Tontäfelchen verdeutlichen die bronzezeitliche (13. Jh. v. Chr.)
Linear B-Schrift (Kat. Nr. 44), früheste Inschriftenfunde des
8. Jahrhunderts v. Chr. die rasche Entwicklung und Verbreitung
der neuen Schrift.
In Sektion 2, "Vorgeschichte der Homerischen
Epen", wird der Fundus an alten Mythen und Formeln, deren sich
auch noch Homer ganz selbstverständlich bediente, anhand von mehreren
Funden aufgezeigt, die fast alle aus dem Archäologischen Nationalmuseum
in Athen ausgeliehen werden konnten. Darunter ragt etwa ein Kriegerkopf
aus Mykene (Kat. Nr. 59) heraus, der einen Eberzahnhelm zeigt,
wie ihn Homer in der Ilias beschreibt (10.260-265. 268-270) -
ein eindeutiges Relikt aus der Bronzezeit, das im 8. Jahrhundert
v. Chr. vielleicht noch verehrt, aber nicht mehr getragen wurde.
Um
die Sänger und ihr Wirkungsfeld an den Adelshöfen zu erläutern,
werden im zweiten Teil der Sektion, "Der Afführungsort", die Auftritte
der Sänger (Aoiden) auf Vasen mit Symposions- (Weingelage)-Bildern
dargestellt.
Die Sektion 3 ist ganz den aus dieser Zeit einzig
vollständig erhaltenen Epen "Ilias" und "Odyssee" gewidmet. Mit
Spitzenvasen aus dem Louvre in Paris, dem British Museum in London,
dem Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in Rom und prominenten
Museen aus ganz Europa wird verdeutlicht, dass die Ilias 'nur'
51 Tage im Geschehen um Troia thematisiert. Deshalb ist diese
Sektion aufgeteilt in Darstellungen der vor der Ilias liegenden
Ereignisse (Paris-Urteil, Entführung der Helena, erste Kriegsjahre),
in solche, die in der Ilias geschildert werden (von Agamemnon
und Chryses bis zu Priamos' Bittgang zu Achilleus) und in Handlungs-Darstellungen,
die nach dem 24. Gesang der Ilias spielen (Selbstmord des Aias,
das Troianische Pferd, Eroberung und Fall von Troia usw.).
Sowohl
in der Abteilung "Ilias" als auch in derjenigen, die der Odyssee
gewidmet ist, sind antike und moderne Kunstwerke thematisch zusammengestellt,
was spannende Bildvergleiche auf höchstem Niveau erlaubt. So stehen
etwa Vasen mit der Darstellung des Paris-Urteils dem Holzschnitt
und dem Gemälde von Lucas Cranach (beide Kunstmseum Basel, Kat.
Nr. 76-77) gegenüber. Ebenso verhält es sich bei der Darstellung
der Odyssee: Auch hier kann man beispielsweise die antiken Versionen
des Sirenen-Abenteuers (darunter den einzigartigen Stamnos aus
dem British Museum, Kat. Nr. 184) mit Arnold Böcklins Version
aus Berlin (Kat. Nr. 186) oder jener des Basler Malers Ernst Stückelberg
(Kunstmuseum Basel, Kat. Nr. 187) vergleichen.
Die Ausstellung schliesst mit Sektion 4, wo die
"Überlieferung und Wirkung" Homers bis heute gezeigt werden. Hier
werden Fragen wie 'Wie sind die Texte Homers bis in unsere Zeit
überliefert worden?' oder: 'Warum haben Homerische Motive bis
heute eine derart ungebrochene Konjunktur?' einerseits durch Papyri,
wie diejenigen aus Köln (Kat. Nr. 200-203), und Codices, andererseits
durch illuminierte Handschriften und Gemälde veranschaulicht,
um den Besuchern einen Überblick über die Rezeption Homers vom
Mittelalter über die Renaissance, die Barockzeit und die weiteren
Epochen bis heute zu vermitteln. Die jüngsten Werke sind vier
monumentale Tafeln von Sigmar Polke von 1982 mit dem Titel Der
Traum des Menelaos (Kat. Nr. 230) und ein Video von Peter Rose
aus dem Jahre 2006 (Kat. Nr. 229), mit dem die Besucher in der
Heimat des Odysseus angekommen sind, es heisst schlicht: Odysseus
in Ithaca.
|