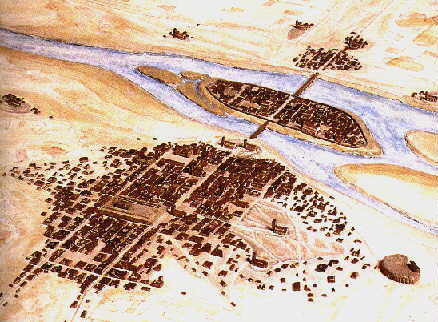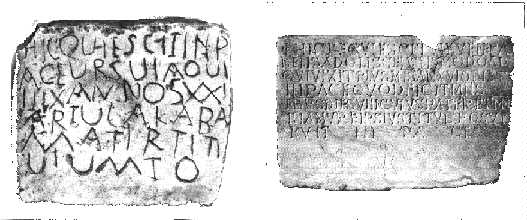|
In den vier
ausgestellten Grabsteinen aus Trier zeigt sich sowohl das Nebeneinander
von Germanen und Romanen in der Stadt als auch der allmähliche
Verlust der klassischen Eleganz in Sprache und Schrift.
Das römische
Köln wurde um 460 zum Königssitz der Rheinfranken, die
sich damit dem Brauch der anderen fränkischen Kleinkönigtümer
anschlossen, die römischen Strukturen soweit wie möglich
weiterzupflegen - wiel sie ja eben sich selbst in der römischen
Kontinuität stehend ansahen. Auch hier wurden, wie in Trier,
die römischen Großbauten kontinuierlich weiterbenutzt
und verschwanden nach und nach erst im Lauf der hohen Mittelalters.
Unter den Nachfolgern Chlodwigs lebte die rheinfränkische
Tradition weiter, jüngere Söhne, die den östlichen
Reichsteil erhalten sollten, wurden aus rheinfränkischem
Namengut benannt, immer wieder hielten sich austrasische Könige
hier auf.
Einer der
Bauten, das römische Prätorium am Rheinufer, wurde von
den Frankenkönigen als Regierungssitz weitergenutzt - und
blieb mit allen Nachfolgebauten bis heute Sitz staatlicher Verwaltungen.
Als nach dem 2. Weltkrieg der heutige Neubau errichtet wurde,
stieß man auf die römischen Grundmauern und ließ
sie im Keller den Neubaus zur Besichtigung frei. Mit dem Fahrstuhl
gelangt der heutige Besucher dorthin - und der Fahrstuhl hat dem
Buch von Rudolf Pörtner, in dem er die Überreste der
Römerzeit in Deutschland beschreibt, den Namen gegeben -
"Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit".
Was das Childerichgrab
in Tournai für die Salfranken des 5. Jahrhunderts ist, ist
das Damengrab unter dem Kölner Dom für die Rheinfranken
des 6. Jahrhunderts.
Seine Auffindung
unter dem Chor des Kölner Doms war eine Sensation in vielerlei
Hinsicht. Der Leichnam selbst bestand zwar nur noch aus einzelnen
Zähnen, einzelnen Röhrenknochen und Knochenresten, vermutlich
vom Schädel, aber die außergewöhnlich reichen
Beigaben erlaubten die sichere Identifizierung als das Grab einer
Frau.
Vier Münzen
lieferten einen Anhaltspunkt für die Datierung um 535. Auffallend
war der reiche, überwiegend goldene Schmuck: eine golddurchwebte
Stirnbinde, beide Ohrringe, einen Armring, ein umfangreicher Halsschmuck
mit Gold-, Glas- und Bernsteinperlen, dazu Almandin und Münzanhänger,
zwei Rosettenfibeln mit Goldkette, ein Armreif und zwei Fingerringe,
die beiden Bügelfibeln von typisch langobardisch-thüringischer
Form mit typisch langobardischem Ziergehänge, dann beide
Schuhschnallen und Wadenbindenriemenzungen. Nägel und Holzreste
beweisen, daß die Dame in einem Sarg beigesetzt war. Außerhalb
des Sargs befanden sich Bronzebecken, Glasschalen und -flaschen,
eine davon in einem Eimer. Eine Flasche enthielt noch Wasser in
einer Qualität, die selbst heutige Chemiker vor Rätsel
stellt. Nüsse und Kerne weisen auf eine Speisebeigabe hin.
In einem Holzkasten mit Bronzebeschlägen befanden sich Spinnwirtel
und ein Schuh. Eine Wolldecke lag auf dem Sarg.
Obwohl jeder
Hinweis auf den Namen der Toten fehlt, spricht vor allem der Bestattungsplatz
innerhalb der Stadtmauer neben der Bischofskirche dafür,
daß sie eine Angehörige des merowingischen Königshauses
war. Auf Grund der Datierung und dem langobardisch beeinflußten
Schmuck ist es recht wahrscheinlich, daß hier Wisigarde,
die zweite Frau Theudeberts, bestattet wurde.
|