Grünewald
Blicke auf ein Meisterwerk
Exposition d'intérêt national
8. Dezember 2007 - 2. März 2008
Musée d'Unterlinden, Colmar
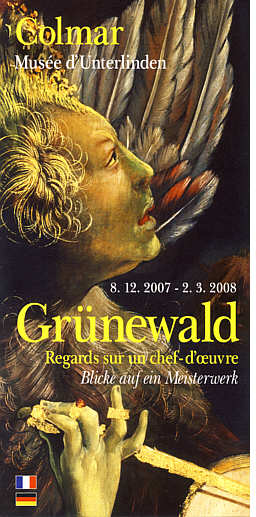 Erstmals
in Frankreich widmet das Musée d'Unterlinden, das den berühmten
Altar der Antoniter von Isenheim aufbewahrt, dem Urheber
dieses Meisterwerks, der einer der größten deutschen Maler
der Renaissance war, eine eigene Ausstellung: "Grünewald.
Blicke auf ein Meisterwerk". Mit dieser Ausstellung führt
das Museum seine Politik fort, die darauf abzielt, seine
beachtliche Sammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem
15. und 16. Jahrhundert einem breiten Publikum bekannt zu
machen und ihre Erforschung zu fördern. Diese Kunstwerke
sind repräsentativ für eine Epoche, in der der Oberrhein
geradezu ein "Goldenes Zeitalter" erlebte. Erstmals
in Frankreich widmet das Musée d'Unterlinden, das den berühmten
Altar der Antoniter von Isenheim aufbewahrt, dem Urheber
dieses Meisterwerks, der einer der größten deutschen Maler
der Renaissance war, eine eigene Ausstellung: "Grünewald.
Blicke auf ein Meisterwerk". Mit dieser Ausstellung führt
das Museum seine Politik fort, die darauf abzielt, seine
beachtliche Sammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem
15. und 16. Jahrhundert einem breiten Publikum bekannt zu
machen und ihre Erforschung zu fördern. Diese Kunstwerke
sind repräsentativ für eine Epoche, in der der Oberrhein
geradezu ein "Goldenes Zeitalter" erlebte.
In der sich seit um 1400 in ganz Europa entwickelnden "Gotik",
deren Stilmerkmale unter anderem fließende Linien und elegante
Gesten sind, bildet sich gegen 1450 eine realistische und
intimistische Strömung in der rheinischen Kunst heraus.
Zu dieser Zeit gehört diese Region zum Heiligen Römischen
Reich deutscher Nation. Die oberrheinischen Künstler der
frühen Neuzeit arbeiten in Straßburg, Colmar, Freiburg im
Breisgau oder Basel.
Die Ausstellung zielt darauf ab, die Chronologie des Schaffensprozesses
für den Isenheimer Altar zu präzisieren und unsere Kenntnisse
über Grünewalds Identität aufgrund neuester Forschungen
zu festigen. Dafür nutzt sie die Ergebnisse jahrelanger
Untersuchungen, die vom Centre de Recherche et de Restauration
des Musées de France (C2RMF) am Isenheimer Altar durchgeführt
wurden, wie auch die Erkenntnisse eines internationalen
Kolloquiums, das im Januar 2006 in Colmar abgehalten wurde.
In Zusammenarbeit mit dem Berliner Kupferstichkabinett,
das einen Großteil von Grünewalds graphischem Oeuvre besitzt,
rückt die Ausstellung den Arbeitsprozess in den Mittelpunkt,
dem wir dieses monumentale Meisterwerk verdanken.
Der Isenheimer Altar
Um 1512 bis 1516 malt Grünewald sein Hauptwerk, den berühmten
Altar für das Antoniterkloster in Isenheim, einem Dorf,
das etwa 20 Kilometer von Colmar entfernt liegt. Auftraggeber
ist Guido Guersi, Präzeptor des Antoniterordens von 1490
bis 1516. Die Plastiken werden um 1515 von Nikolaus Hagenauer
ausgeführt. Der Antoniterorden wurde 1092 gegründet; seine
Berufung war die Pflege und Behandlung der Kranken, die
am Antoniusfeuer litten. Verursacht wird dieses Leiden durch
das Mutterkorn, einen Pilz, der auf den Ähren von Roggen
wächst. Das um 1300 gegründete Antoniterkloster von Isenheim
häufte nach und nach einen beträchtlichen Reichtum an, der
es ihm ermöglicht, zahlreiche Kunstwerke in Auftrag zu geben
und zu finanzieren. Der dem heiligen Antonius geweihte Wandelaltar
ist ein solches Auftragswerk. Ursprünglich war er für den
Chor der Antoniterkirche bestimmt. Dort stand er bis zur
Französischen Revolution. Um seine Zerstörung zu verhindern,
wurde er 1792 nach Colmar in die Bibliothèque Nationale
du District gebracht. 1852 siedelte er in die Kirche des
ehemaligen Dominikanerinnenklosters Unterlinden um, das
damals zu einem Museum umgebaut wurde. Seitdem ist er das
berühmteste Werk des Museums, das die Betrachter nach wie
vor in seinen Bann schlägt. Der geschlossene Altar stellt
die Figur des toten Christus am Kreuz dar. Die weiteren
Tafeln sind Darstellungen der Auferstehung, der Verkündigung,
des Engelskonzerts, der Versuchung des heiligen Antonius
und des heiligen Antonius beim heiligen Paulus gewidmet.
Grünewald und seine Zeitgenossen
Eine
neue Künstlergeneration beherrschte die Epochenschwelle
um 1500: Wesentliche Meister der Renaissance sind Mathias
Grünewald (um 1475/80-1528), Hans Holbein d.Ä. (um 1465-1524),
Albrecht Dürer (1471-1528), Lucas Cranach (1472-1553), Albrecht
Altdorfer (1480-1538), Hans Baldung Grien (um 1484-1545),
Meister I.P. und Meister H.L. Ihre Leistungen sind wesentlich
mit der künstlerischen Blüte verknüpft, die Deutschland
in dieser Zeit erlebte. In der Ausstellung "Grünewald.
Blicke auf ein Meisterwerk" werden den Vorzeichnungen zum
Altar Zeichnungen anderer Künstler gegenübergestellt, die
Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen
Raum entstanden. Dadurch wird Grünewalds persönlicher Stil
ersichtlich, der ihn von der vorhergehenden Künstlergeneration
und seinen Zeitgenossen unterscheidet.
Themenkreise der Ausstellung
Religiöse Szenen
Im Vergleich mit Arbeiten
seiner Zeitgenossen (Zeichnungen, Plastiken) wird nicht
nur Grünewalds Originalität offensichtlich, sondern auch
der Wandel in der Auffassung verschiedenster religiöser
Motive am Beginn des 16. Jahrhunderts. Gleichzeitig tritt
der expressive Wille zutage, der diesen Künstlern im beginnenden
16. Jahrhundert gemeinsam ist. Neben die Zartheit der Mariendarstellungen
mit der ausgeprägten Betonung ihrer Menschlichkeit (Altdorfers
"Heilige Familie", Basel) tritt eine drastische Darstellung
des Schmerzes und der offensichtlichen Gewalt, die das Passionsgeschehen
beherrscht ("Kreuzigung" von Cranach, Berlin; "Beweinung"
von Hans Baldung Grien, Washington). Naturalismus und
Expressivität
Die Figuren werden zunehmend realistischer
dargestellt: die Gesichter ausdrucksstark, die Körper differenziert
durchmodelliert. Die Künstler interessieren sich tiefer
für die Anatomie des menschlichen Körpers, wie Grünewalds
Studien für den "Heiligen Sebastian" des Isenheimer Altars
oder Dürers Arm- und Handstudien belegen. Auch der Gesichtsausdruck
wird genau beobachtet: flehend bei Maria Magdalena, ernst
bei den heiligen Eremiten. Die Rolle der Landschaft in
der graphischen Ausarbeitung der Werke
Die Landschaften
im Hintergrund mit ihren unzähligen Details zeigen die Nähe
zwischen Grünewald und den Auffassungen flämischer Maler
und der nordeuropäischen Landschaftskunst. Immer häufiger
erarbeiten die Künstler Baum- oder Vegetationsstudien. In
der Tafel mit dem "Heiligen Paulus beim heiligen Antonius"
des Isenheimer Altars wie auch in einigen Zeichnungen von
Altdorfer verschmelzen die Figuren geradezu mit der üppigen
Natur, die sie umgibt. Gewandstudien
Beim Malen von Gewändern
und Falten können die Künstler ihre Virtuosität zur Schau
stellen. Die Stoffe werden detailreich wiedergegeben: einige
Frauen tragen Gewänder mit weich fallenden Falten; die Kleider
anderer - so das der "Jungfrau mit dem Kind" auf dem Isenheimer
Altar - sind dagegen aus schwerem Stoff, und der Faltenwurf
weist erstaunliche Ähnlichkeiten mit Zeichnungen von Leonardo
da Vinci auf.
Technische Analyse des Altars
Ergänzt
wird die Ausstellung durch Material, das die vom C2RMF am
Isenheimer Altar durchgeführten Analysen dokumentiert (Röntgenaufnahmen,
Infrarotreflektographien, stratigraphische Analyse der
Farbschicht). Sie beleuchten den Schaffensprozess, der diesem
Meisterwerk zugrunde liegt. Die Arbeitsetappen wurden mit
Hilfe von Röntgenaufnahmen und Infrarotreflektographien
analysiert. Im ersten Stadium der Vorbereitung ritzte Grünewald
bestimmte Stellen ein, um Elemente wie die Anordnung der
Pfeile in der Tafel mit dem "Heiligen Sebastian" oder die
runden Fenstergläser hinter dem "Heiligen Antonius" auf
der Bildfläche festzulegen. Die Art und Weise, wie die Unterzeichnung
ausgeführt wurde, konnte dagegen nicht genau bestimmt werden,
da sie nur schwierig auszumachen ist. Fotos und Infrarotreflektographien
lassen vermuten, dass sie mit dem Rötel- und nicht mit dem
Kohlestift ausgeführt wurde. Schraffuren - wie etwas bei
Albrecht Dürer - finden sich bei Grünewald nicht - eine
Ausnahme und eine Neuerung im Vergleich zum Vorgehen seiner
Zeitgenossen. Grünewalds Anwendung von Zeichnungen im Werkprozess
hat größere Ähnlichkeit mit jener Technik, die zu dieser
Zeit in Italien üblich war.
Im Lauf des Malprozesses korrigiert oder verändert Grünewald
nur wenige Elemente der Komposition. Die Linie als Grundelement
von Grünewalds Maltechnik zieht sich wie ein roter Faden
durch sämtliche Etappen des Werkprozesses hindurch. Sie
geht einher mit einer meisterlichen Beherrschung der Farbe.
Kunstlandschaft Oberrhein
Grünewald und seine
Zeitgenossen entfalteten ihre schöpferische Tätigkeit in
einer Zeit, in der die Rheingrenze zwischen Frankreich und
Deutschland nicht existierte. Damals war die oberrheinische
Region eine Art Schmelztiegel, in dem die großen künstlerischen
Strömungen Europas zusammenflossen. Es schien uns wichtig,
an diese grenzüberschreitende Dimension anzuknüpfen, und
zwar in Form einer Zusammenarbeit mit der Staatlichen Kunsthalle
Karlsruhe, die zeitgleich eine Ausstellung über Grünewald
organisiert, in der die Grisaille-Technik und die mit der
Passion Christi verbundenen Themen in den Mittelpunkt gestellt
werden.
Neben dem Berliner Kupferstichkabinett und der Staatlichen
Kunsthalle in Karlsruhe haben weitere renommierte Institutionen
lebhaftes Interesse an diesem Projekt bekundet. Der Louvre
und die Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris,
die Museen in Rennes, Basel, Budapest, Dresden, München,
London, Rotterdam und Washington leihen dem Musée d'Unterlinden
Meisterwerke aus ihrem graphischen Bestand.
|
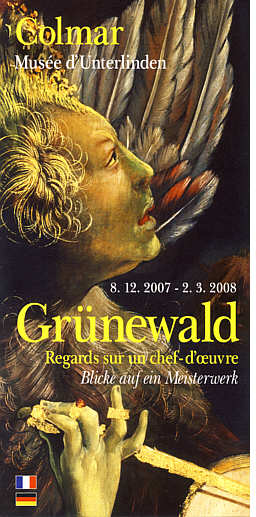 Erstmals
in Frankreich widmet das Musée d'Unterlinden, das den berühmten
Altar der Antoniter von Isenheim aufbewahrt, dem Urheber
dieses Meisterwerks, der einer der größten deutschen Maler
der Renaissance war, eine eigene Ausstellung: "Grünewald.
Blicke auf ein Meisterwerk". Mit dieser Ausstellung führt
das Museum seine Politik fort, die darauf abzielt, seine
beachtliche Sammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem
15. und 16. Jahrhundert einem breiten Publikum bekannt zu
machen und ihre Erforschung zu fördern. Diese Kunstwerke
sind repräsentativ für eine Epoche, in der der Oberrhein
geradezu ein "Goldenes Zeitalter" erlebte.
Erstmals
in Frankreich widmet das Musée d'Unterlinden, das den berühmten
Altar der Antoniter von Isenheim aufbewahrt, dem Urheber
dieses Meisterwerks, der einer der größten deutschen Maler
der Renaissance war, eine eigene Ausstellung: "Grünewald.
Blicke auf ein Meisterwerk". Mit dieser Ausstellung führt
das Museum seine Politik fort, die darauf abzielt, seine
beachtliche Sammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem
15. und 16. Jahrhundert einem breiten Publikum bekannt zu
machen und ihre Erforschung zu fördern. Diese Kunstwerke
sind repräsentativ für eine Epoche, in der der Oberrhein
geradezu ein "Goldenes Zeitalter" erlebte.