|
Die
Pfahlbauer - Welt im Umbruch
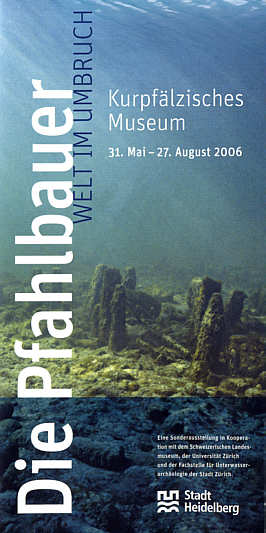 Im
Winter 1854 wurde am Ufer des Zürichsees die erste Pfahlbausiedlung
entdeckt. Das Ereignis bedeutete eine archäologische Sensation,
welche auf weltweites Interesse stiess und einen Meilenstein
in der Entwicklung der Archäologie darstellte. Die Entdeckung
der Pfahlbauten eröffnete der Archäologie neue Dimensionen,
die über die Welt der Gräber und der Toten hinausging. Die
Objekte aus den Seeufersiedlungen gaben Zeugnis vom alltäglichen
Leben. So rückte die Urgeschichte in die unmittelbare Nähe
des modernen Betrachters. Im
Winter 1854 wurde am Ufer des Zürichsees die erste Pfahlbausiedlung
entdeckt. Das Ereignis bedeutete eine archäologische Sensation,
welche auf weltweites Interesse stiess und einen Meilenstein
in der Entwicklung der Archäologie darstellte. Die Entdeckung
der Pfahlbauten eröffnete der Archäologie neue Dimensionen,
die über die Welt der Gräber und der Toten hinausging. Die
Objekte aus den Seeufersiedlungen gaben Zeugnis vom alltäglichen
Leben. So rückte die Urgeschichte in die unmittelbare Nähe
des modernen Betrachters.
Noch interpretierte man allerdings die Funde dahingehend,
dass die Häuser auf gemeinsamen Plattformen im See standen
- und das romantische Bild vom Leben der Ur-Schweizer auf
dem See entstand.
Später zeigte sich, dass Seeufer- und Moorsiedlungen keine
schweizerische Eigenschaft darstellen: Es handelt sich vielmehr
um ein Phänomen, das von der Jungsteinzeit (ca. 4300 v. Chr.)
bis zum Ende der Bronzezeit um 800 v. Chr. rund um die Alpen
(von Ostfrankreich und Süddeutschland bis nach Italien und
Slowenien) verbreitet war. Darüber hinaus wurde das Bild von
auf Seeplattformen errichteten Dörfern nach dem 2. Weltkrieg
verworfen. Man erkannte, dass die Seen zu unterschiedlichen
Zeiten unterschiedliche Wasserstände hatten, so dass die Siedlungen
der Jungsteinzeit und der Bronzezeit nicht im See, sondern
am Ufer standen.
Im Verlauf dieser langen Siedlungsgeschichte veränderte der
Mensch nicht nur die Landschaft, indem er für seinen Holzbedarf
und den Ackerbau den Wald zurückdrängte, es gelang ihm auch
mit grundlegenden technischen Innovationen seine Welt entscheidend
zu verändern. Erfindungen wie die Metallverarbeitung oder
Rad und Wagen ermöglichten eine verbesserte Nahrungsversorgung
und den Handel mit weit entfernten Regionen.
Die Archäologie der Pfahlbauten beruht auf der Tatsache, dass
der besonders geringe Sauerstoffanteil im Wasser auch Holz,
Textilien und Nahrungsreste, die üblicherweise in wenigen
Jahren zerfallen wären, konservierte. So treten bei Niedrigwasserständen
immer wieder Überreste von Pfählen aus dem Schlick hervor.
Grabungen erfolgen entweder durch Trockenlegung der Fundfläche
oder mit den Mitteln der Unterwasserarchäologie.
Warum wurde auf Pfähle gebaut?
Die Seen des Alpenvorlandes verzeichnen in Abhängigkeit
vom jährlichen Wasserzufluss hohe Schwankungen des Wasserstands.
Während im Winter durch den Schneefall in den Bergen wenig
Wasser zufließt, wirken sich die Zuflüsse der Schmelzwässer
im Frühjahr, die ab März einsetzen, besonders kräftig aus.
Sie können den Seespiegel in nur drei Monaten um drei Meter
wachsen lassen. Im Jahresmittel schwankt der Spiegel des
Bodensees heute zwei Meter.
Im Wechselspiel zwischen Sedimentation und Erosion veränderten
sich vor dem Eingriff des Menschen Uferlinie und Untergrund
ständig. Die Menschen mussten eine Balance finden zwischen
der Siedlung in unmittelbarer Nähe des Wassers - für Fischfang
und Transport - und der Notwendigkeit, ihre Häuser auch
bei hohen Wasserständen trocken zu halten. Das war nur mit
der Bauweise der Häuser auf Pfählen möglich, die auch heute
noch in anderen Gegenden der Welt eine weit verbreitete
Siedlungsweise darstellt.
Dass die Pfahlbauten dagegen zum Schutz vor Feinden in den
See hineingebaut wurden, kann in den Bereich der Märchen
verwiesen werden.
Die Ausstellung, die das Schweizerische Landesmuseum Zürich
zum 150. Jubiläum der Pfahlbaufunde konzipierte. ist
in Deutschland nur in Heidelberg zu sehen. Eigens für diese
Station wurde eine Installation verwirklicht, die die 100
berühmtesten und zum Teil skurrilen Funde aus den Pfahlbausiedlungen
in eine stimmungsvolle Seeuferlandschaft setzt. Auf nachgebildeten
Sandbänken, zwischen Kies und Schilf sind "Pfahlbaufunde"
gestreut, eingefasst in einfache Glashauben. Die Lage der
Funde folgt einzelnen Lebensräumen, wie etwa "Wirtschaft
am See - Die Fischer", "Die Bauern - Revolution mit der
Steinsichel" oder aber "Ein Tempel aus der Bronzezeit?".
Das flirrende türkisblaue Licht und ein raumhohes, darauf
abgestimmtes Unterwasserbild unterstreichen die Stofflichkeit
der Objekte. Im Vordergrund steht dabei die Ästhetik und
die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die die jahrtausendealten
Formen, Verzierungen und Materialien in neuem Glanz erstrahlen
lassen.
Etwa 6000 Jahre reicht der Blick zurück in die Vergangenheit
- auf die Lebensgewohnheiten der damaligen Menschen. Die
Faszination der Gegenstände liegt im Detail. Viele der Funde
aus dem prähistorischen Alltag - in aufwändiger und hochmoderner
Arbeit restauriert - wirken, als hätte sie ihr ursprünglicher
Besitzer eben erst aus der Hand gelegt. Von gerade gesammelten
Wildäpfeln über hölzerne Küchenhelfer und Spielzeug bis
hin zu Kultobjekten und einer wunderschönen, in Gold eingefassten
Bernsteinperle reichen die Ausstellungsstücke. Sie berichten
nicht nur von einer längst vergangenen Zivilisation, sondern
lassen den Besucher auch in die Pfahlbaukultur abtauchen.
|
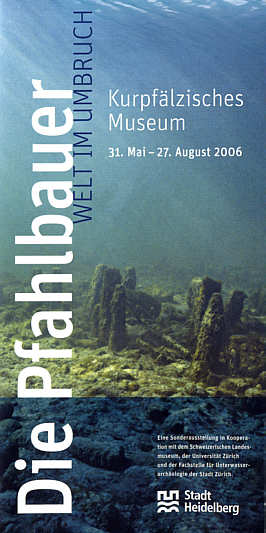 Im
Winter 1854 wurde am Ufer des Zürichsees die erste Pfahlbausiedlung
entdeckt. Das Ereignis bedeutete eine archäologische Sensation,
welche auf weltweites Interesse stiess und einen Meilenstein
in der Entwicklung der Archäologie darstellte. Die Entdeckung
der Pfahlbauten eröffnete der Archäologie neue Dimensionen,
die über die Welt der Gräber und der Toten hinausging. Die
Objekte aus den Seeufersiedlungen gaben Zeugnis vom alltäglichen
Leben. So rückte die Urgeschichte in die unmittelbare Nähe
des modernen Betrachters.
Im
Winter 1854 wurde am Ufer des Zürichsees die erste Pfahlbausiedlung
entdeckt. Das Ereignis bedeutete eine archäologische Sensation,
welche auf weltweites Interesse stiess und einen Meilenstein
in der Entwicklung der Archäologie darstellte. Die Entdeckung
der Pfahlbauten eröffnete der Archäologie neue Dimensionen,
die über die Welt der Gräber und der Toten hinausging. Die
Objekte aus den Seeufersiedlungen gaben Zeugnis vom alltäglichen
Leben. So rückte die Urgeschichte in die unmittelbare Nähe
des modernen Betrachters.