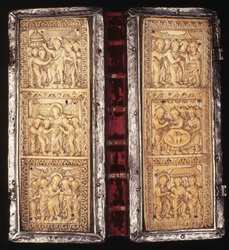 Buch- und Elfenbeinkunst Buch- und Elfenbeinkunst
Dieser Teil der Ausstellung führt in die faszinierende
Welt der karolingischen Buchkunst. Ab dem ausgehenden 8. Jahrhundert
entstehen prächtige Handschriften mit teilweise Purpur eingefärbten
Pergamentseiten und Einbänden mit Elfenbeintafeln. Das an
Karls Hof in Aachen ansässige Zentrum der Buchkunst strahlt
weit in das Fränkische Reich hinein.
Präsentiert
wird Buchkunst aus verschiedenen Zentren des Fränkischen
Reiches, zu denen auch das Kloster St.Gallen gehörte. Dort
werden auch die geschnitzten Elfenbeintafeln aufbewahrt, die
Karl der Grosse zu seiner Kaiserkrönung erhielt und als
Leihgaben in der Ausstellung zu sehen sind. Zu den Highlights
in diesem Teil der Ausstellung gehört der Liber Viventium – das
Buch der Lebenden und Toten – entstanden im Kloster Pfäfers
kurz nach Karls Tod. Das reich bemalte Werk – eine Leihgabe
des Stiftsarchivs St.Gallen - listet gegen 4'500 Namen verbrüderter
Mönche, von Stiftern oder Wohltätern auf – darunter
auch Karls Vater Pippin, Karl der Grosse und sein Bruder Karlmann.
Kirche und Religion – Karl als Schutzherr der
Kirche und der Christen
Vom Papst zum Kaiser gekrönt verstand sich Karl der Grosse
als Schutzherr der Kirche und der Christen. Das aus der Domschatzkammer
Aachen stammende Brustkreuz wird Karl dem Grossen zugeschrieben.
Gefunden bei der Graböffnung im Jahre 1000 erinnert es an
Karl als gläubiger Christ. Als ihn Papst Leo III. im Jahre
800 zum Kaiser krönte, übernahm Karl – so wie
vor ihm sein Vater Pippin – die Verantwortung für
die Verbreitung des Christentums. Er hat zahlreiche Kirchen bauen
lassen, die Liturgie vereinheitlicht und die Bibel revidieren
lassen. Von seinen Bestrebungen, die Verbreitung des Christentums
voranzutreiben, zeugt in der Ausstellung unter anderem das älteste
erhaltene Vaterunser in deutscher Sprache, eine der zahlreichen
Leihgaben der Stiftsbibliothek St.Gallen.
In diesem Teil der Ausstellung sind Reliquiare und weitere Kirchenschätze
versammelt, die vom Reichtum des karolingischen Erbes aus der
Schweiz zeugen.
 Pfalzen – Bauboom herrschaftlicher Residenzen Pfalzen – Bauboom herrschaftlicher Residenzen
Karl der Grosse hat die Architektur verändert. Er liess
nördlich der Alpen die ersten monumentalen Steinbauten seit
der Römerzeit erstellen: Die Pfalzanlagen. Es sind Herrschersitze
und – verteilt im ganzen Fränkischen Reich – Machtsymbole
auf Zeit für einen Herrscher, der immerfort auf Reisen war.
Architektur und Funktion orientieren sich dabei an römischen
Kaiserpalästen – auch das ein sichtbares Zeichen von
Karls Rückgriff auf die Spätantike und das frühe
Christentum. Seine Lieblingsresidenz war Aachen.
Auf dem Lindenhof entsteht in karolingischer Zeit die erste
repräsentative Königspfalz. Wir stellen sie vor und
geben Einblick in das Zürich des 8. und 9. Jahrhunderts.
Präsentiert wird in diesem Zusammenhang eine Urkunde aus
dem Jahr 807, in der zum ersten Mal die Siedlung an der Limmat
erwähnt wird.
Karl war nicht nur König und Kaiser, sondern auch Krieger.
Mit seinen fast jährlichen Kriegszügen hat er weite
Gebiete erobert und christianisiert. Besonders zu erwähnen
sind die langanhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen mit
den heidnischen Sachsen, deren Niederlage mit der Taufe ihres
Anführers, Widukind, und der Christianisierung der Sachsen
endete. Karolingische Waffen aus dem In- und Ausland geben Zeugnis
der Kriegsführung Karls des Grossen und Aufschluss über
die Ausrüstung der Karolinger.
Epilog – Karl der Grosse: Legenden und Mythen
Kaum ist Karl der Grosse 814 in Aachen gestorben, wird er zum
Mythos, und zahlreiche Legenden ranken sich um seine Person.
Beleg dafür ist eine um 883 vom St.Galler Mönch Notker
verfasste Biografie – die Gesta Karoli Magni – von
der eine Abschrift vorgelegt wird.
Eine Übersicht über die Ereignisse nach Karls Tod
im Jahr 814 bis zum Ende der Dynastie der Karolinger 888 legt
dar, wie das Fränkische Reich nach Karls Tod wieder in Einzelgebiete
zerfällt.
Zahlreich sind die Werke, die den frühen und bis heute
anhaltenden Karlskult in Zürich belegen. Darstellungen auf
Glasscheiben, Gemälden und Silberpokalen zeigen ihn als
vermeintlichen Gründer des Großmünsters oder
verehren ihn als einen Heiligen.
Dass auf europäischer Ebene sowohl Frankreich wie auch
Deutschland Karl den Grossen als ihren Herrscher beanspruchen,
symbolisieren – als Ausklang der Ausstellung – zwei
einander gegenübergestellte Porträts: das Idealporträt
Karls des Grossen als deutschen Kaiser aus der Werkstatt Albrecht
Dürers und der französische «Charlemagne» des
Historienmalers Louis-Félix Amiel von 1839. |