Zur Siedlungsgeschichte des Bergs
5500— 5000
Äus der Zeit der Bandkeramik zeugen nur einzelne Funde
von sporadischen Begehungen des Bergs
5000—4400
Erste Spuren von ständiger Besiedlung aus der Mittleren
Jungsteinzeit: Steinbeile, häusliche Gerätschaften
und Gefäßscherben der Rössener Kultur besonders
auf der hinteren Bergkuppe.
Danach bleibt der Berg für längere Zeit ohne Bedeutung für die
Siedlung der Umgegend.
1200
In der ausgehenden Bronzezeit, der Urnenfelderkultur (Hallstatt
B), entsteht eine erste geschlossene, weit über den inneren
Ringwall hinausreichende Siedlung. Aus dieser Zeit stammt das
bronzene Ortband einer Schwertscheide, das sowohl auf die Existenz
einer waffentragenden Oberschicht hinweist als auch die Verbindungen
zur englisch-französischen Urnenfelderkultur belegt.
480—280
Größte Ausdehnung der keltischen Höhensiedlung
zwischen den Perioden Hallstatt D 3 und Latène B mit der
Errichtung der mächtigen frühlatènezeitlichen
Doppelwallanlage. Auf den terrassierten Steilhängen und
auf den beiden Bergkuppen, vor allem aber an der Nord- und Westseite,
entstanden weit über 400 Hüttenplätze.
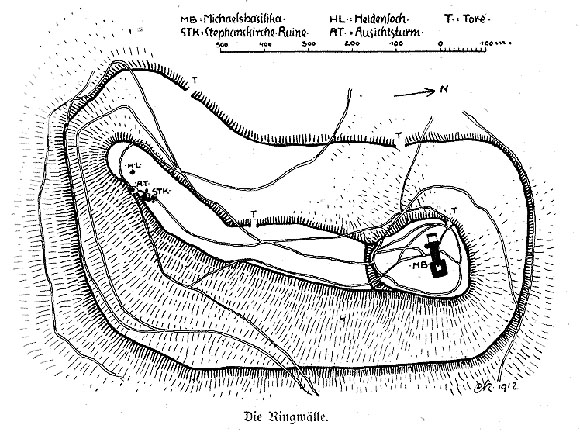
Gesamtplan der keltischen Ringwälle und
der Klosteranlagen
aus: Rudolf Sillib: Der heilige Berg bei Heidelberg.
Schriftenreihe Vom Bodensee zum Main der Badischen Heimat,
11 (1920). S. 5.
Die befestigte Keltensiedlung ("städtisch zu nennende
Großsiedlung von zweifellos überregionaler Bedeutung",
R. Ludwig) erhält für die Dauer ihrer Existenz für
das gesamte Untere Neckarland zentrale Bedeutung; die wirtschaftliche
Grundlage der Siedlung bildet Eisenverhüttung und -verarbeitung,
die sicher in den Händen einer Ober- oder Fürstenschicht
lag. Zur politischen und wirtschaftlichen Stellung tritt die
zentrale kultische Stellung. Der Keltenkopf von Bergheim ist
der einzige Hinweis auf einen möglichen, dem Rang des
Heiligenberges entsprechenden keltischen Grabhügel des
5./4. vorchristlichen Jahrhunderts.

Doppelpyramidenförmige
Eisenbarren mit stark ausgezogenen Enden, Gewicht 5,3 bzw.
5,2 Kg.
Dabei Reste eines tönernen Gusstiegels und Eisenschlacken.
Lesefunde vom Westhang des Bergs, zwischen innerem und äußerem
Ringwall.
Heidelberg,
Kurpfälzisches Museum
 Um
280 v. Chr. verliert der Berg seine Mittelpunktfunktion, wird
aber auch in der jüngeren Latènezeit aufgesucht,
wenn nicht sogar jeweils kurzzeitig besiedelt. Die Nachfolgesiedlung,
die die zentrale Funktion übernommen haben muss, ist nicht
bekannt. Lopodunum-Ladenburg ist es jedenfalls nicht. Um
280 v. Chr. verliert der Berg seine Mittelpunktfunktion, wird
aber auch in der jüngeren Latènezeit aufgesucht,
wenn nicht sogar jeweils kurzzeitig besiedelt. Die Nachfolgesiedlung,
die die zentrale Funktion übernommen haben muss, ist nicht
bekannt. Lopodunum-Ladenburg ist es jedenfalls nicht.
Keltenfürst
von Bergheim - Rekonstruktionsversuch
von B. Heukemes
B.
Heukemes rekonstruierte den "Keltenfürsten" als Stele,
dessen Fuß dasselbe Motiv des bekrönten Kopfes noch
einmal zierte. Erst mit der Entdeckung des Keltenfürsten
vom Glauberg wurde deutlich, dass es sich wohl auch beim Keltenfürsten
von Bergheim um den Kopf einer großen Statue handeln
musste.
Kurpfälzisches Museum Heidelberg
|