|
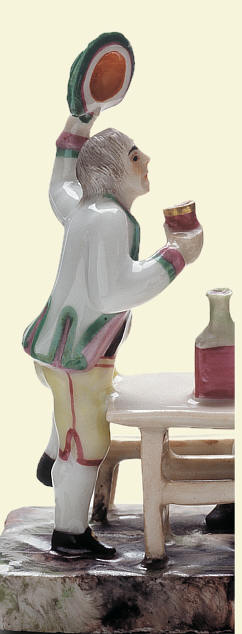
Insgesamt viermal besuchte Herzog Carl Eugen von Württemberg
(reg. 1744-1793) Italien. Die erste Rundreise, einer Kavalierstour
ähnlich, unternahm er 1753 zusammen mit seiner Gemahlin
Elisabeth Friederike. Auf der letzten, einer Bildungs- und
Informationsreise, begleitete ihn 1774/75 die Reichsgräfin
Franziska von Hohenheim. Über die jeweilige Reiseroute und
das Besichtigungsprogramm sind wir durch Tagebücher Mitreisender
informiert und wissen, dass der Herzog jeweils für mehrere
Tage in Venedig Station machte. Die beiden dazwischen
liegenden Italienreisen waren dagegen reine Vergnügungsreisen
mit dem Ziel Venedig. Im Frühsommer 1762 hielt sich Herzog
Carl Eugen drei volle Wochen in der Lagunenstadt auf, 1767
gar ein halbes Jahr. Ein während der Reise 1766/67 akribisch
geführtes Ausgabenbuch lässt keinen Zweifel daran aufkommen,
dass der württembergische Regent seinem Land für ein halbes
Jahr den Rücken kehrte, um sich in Venedig nach Kräften
zu amüsieren - ein ungeheurer Vorgang, auch im 18. Jahrhundert.
Auf insgesamt 230.910 Gulden und 14 ¾ Kreuzer summierten
sich am Ende der Reise die Ausgaben. Der Aufenthalt der
württembergischen Reisegesellschaft in Venedig umspannte
die Zeit vom Karnevalsbeginn bis zur Prunk-Regatta am Himmelfahrtstag.
Zwischen diesen beiden Höhepunkten im venezianischen Festkalender
reihten sich ungezählte Lustbarkeiten - offizielle und private
Empfänge und Feste, Theater- und Opernbesuche, Konzerte
und Bälle - wie Perlen auf einer Kette. Dem einheimischen
Adel gleich, logierte Herzog Carl Eugen mit seinem 125 Personen
umfassenden Gefolge den Winter über direkt in der Stadt,
im Frühjahr dann in einer Villa auf dem nahen Festland. Bei
seiner Rückkehr nach Württemberg im Juli 1767 wurde Herzog
Carl Eugen von den innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten
eingeholt, denen er durch seine Vergnügungsreise nach Venedig
für ein halbes Jahr scheinbar entronnen war. Was lag näher,
als ein Stück heiterer venezianischer Lebensart in den württembergischen
Alltag hinüber zu retten und auf diese Weise wenigstens
die Erinnerung an die sorgenfreien Monate wach zu halten? Maskeraden
waren im 18. Jahrhunderten ein fester Bestandteil höfischer
Festkultur. Als wichtigste Veranstaltung der Karnevalszeit
hatten sich im deutschsprachigen Raum - von Venedig inspiriert
- Maskenfeste, so genannte Redouten, herausgebildet. Der
ausgedehnte Venedig-Aufenthalt Carl Eugens 1767 und seine
Teilnahme am berühmten venezianischen Karneval gaben dem
Maskentragen in Württemberg ganz neue Impulse. Noch unter
dem Eindruck des in Venedig Gesehenen muss in jenem Herbst
1767 bei Herzog Carl Eugen der Plan gereift sein, die so
genannte Venezianische Messe ins Leben zu rufen. Als Kombination
zweier venezianischer Besonderheiten - Maskentreiben und
Warenverkauf unter freiem Himmel - ist sie des württembergischen
Regenten ureigenste Erfindung.
Bild: Galan in der Schenke, Teil der Tafeldekoration
„Venezianische Messe“ © Foto: P. Frankenstein/ H. Zwietasch,
Landesmuseum Württemberg (Ausschnitt)
|