|
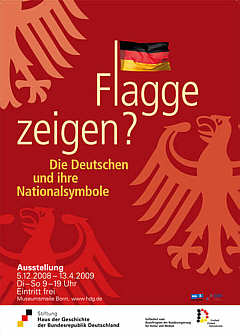 Friedliche
Revolution und Mauerfall standen im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold,
bei der Fußball-Weltmeisterschaft
2006 tauchte ganz Deutschland in ein schwarz-rot-goldenes „Sommermärchen“ ein. „Ich
liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau“, antwortete
im Frühjahr 1969 der spätere Bundespräsident
Gustav Heinemann auf die Frage eines Journalisten. Er charakterisierte
damit das ambivalente Verhältnis vieler Bundesbürger
zu ihrer Nation und nationalen Symbolen wie Flagge, Hymne
und Adler. Was sind die Gründe für diesen Wandel
im Umgang mit den Nationalsymbolen? Friedliche
Revolution und Mauerfall standen im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold,
bei der Fußball-Weltmeisterschaft
2006 tauchte ganz Deutschland in ein schwarz-rot-goldenes „Sommermärchen“ ein. „Ich
liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau“, antwortete
im Frühjahr 1969 der spätere Bundespräsident
Gustav Heinemann auf die Frage eines Journalisten. Er charakterisierte
damit das ambivalente Verhältnis vieler Bundesbürger
zu ihrer Nation und nationalen Symbolen wie Flagge, Hymne
und Adler. Was sind die Gründe für diesen Wandel
im Umgang mit den Nationalsymbolen?
Vom 5. Dezember 2008 bis 13. April 2009 zeigt die Stiftung
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die
Ausstellung „Flagge zeigen? Die Deutschen und ihre
Nationalsymbole“. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres
2009 „60 Jahre Bundesrepublik Deutschland“ fragt
sie nach der Herkunft von Fahne, Hymne und Wappen und beleuchtet
ihre Verwendung in verschiedenen historischen Epochen.
Besonders die Einrichtung von nationalen Gedenk- und Feiertagen
sowie der Umgang mit Denkmälern und Gedenkstätten
in demokratischen Gesellschaften und Diktaturen werfen
ein Schlaglicht auf die unterschiedlichen Motive und Absichten.
Rund 600 Exponate sind in der Ausstellung zu sehen, darunter
eine Fahne des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, das Gemälde „Café Deutschland“ von
Jörg Immendorff sowie Entwurfsskizzen der Kollektion „Mutter,
Erde, Vater, Land“ der renommierten Designerin Eva
Gronbach.
„Flagge zeigen?“ beleuchtet die Entstehung nationaler
Symbole im 19. Jahrhundert, ihre Rolle im Kaiserreich,
in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus exemplarisch.
Nach 1945 ist Schwarz-Rot-Gold das einzige von Krieg und
Terror unbelastete gesamtdeutsche Symbol für die Deutschen
in allen Besatzungszonen. Bei der doppelten Staatsgründung
1949 beschwören
beide deutsche Teilstaaten mit diesen Farben die nationale
Einheit. Zugleich setzen sie unterschiedliche Akzente in
ihrer Erinnerungskultur und grenzen sich im Kalten Krieg
zunehmend voneinander ab.
Die SED begreift die DDR seit den 1970er Jahren als sozialistische
Nation und betreibt die Abgrenzung von der Bundesrepublik.
Diese hält – trotz der in weiter Ferne liegenden
Wiedervereinigung Deutschlands – am Ziel der nationalen
Einheit fest und gibt dieser Politik symbolhafte Zeichen:
Der 17. Juni, der Tag des Volksaufstands in der DDR, wird
nationaler Feiertag, das Brandenburger Tor Sinnbild der
Teilung Deutschlands und des Willens zu ihrer Überwindung.
Die DDR setzt auf die Traditionen der Arbeiterbewegung
und der Kommunistischen Internationale: Sie feiert vor
allem den 1. Mai als internationalen Kampftag der Arbeiterklasse,
den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus und die
Staatsgründung am 7. Oktober.
Friedliche Revolution und deutsche Einheit stehen 1989/90
im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold. Die Staatssymbole der
DDR werden nach der deutschen Wiedervereinigung aus der Öffentlichkeit
entfernt, während in den Medien erste Diskussionen
um den Erhalt „sozialistischer“ Denkmäler
beginnen. Vor allem in der Hauptstadt Berlin setzt das
vereinigte Deutschland – begleitet von regen öffentlichen
Diskussionen – bauliche Signale für das Selbstverständnis
der Republik: Nach dem Umbau gibt das Reichstagsgebäude
als Sitz des Deutschen Bundestages mit einer begehbaren
gläsernen Kuppel dem politischen Berlin ein populäres
Erkennungsmerkmal. Das wiedervereinigte Deutschland bekennt
sich zu seiner historischen Verantwortung und setzt der
Erinnerung an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft
mit der Neukonzeption der Gedenkstätte „Neue
Wache“ und dem „Denkmal für die ermordeten
Juden Europas“ Zeichen.
|