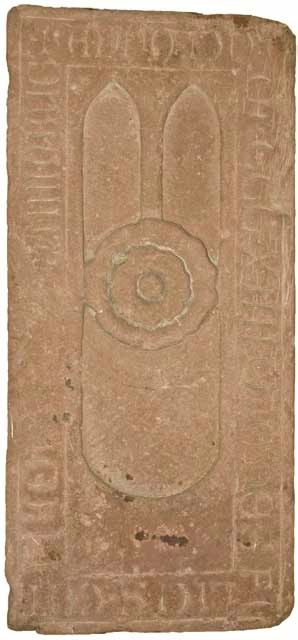Die älteste, aus dem Heidelberger Stadtgebiet stammende
Grabplatte, möglicherweise eine der frühesten Kindergrabplatten
Baden- Württembergs überhaupt, ist der Grabstein des
Johannes, Sohn des Gottfried, der, wie die lateinische Inschrift
besagt, am 2. August im Jahr des Herrn 1314 verstarb. Die Platte
aus rotem Sandstein hat eine umlaufende gotische Majuskel, die
den ersten Hinweis auf eine Heidelberger Bürgerfamilie liefert,
welche urkundlich bislang nicht nachweisbar ist. Besonders auffällig
an der Grabplatte ist eine fein ausgearbeitete Rose unter zwei
angedeuteten gotischen Spitzbögen im Zentrum des Steins,
wozu bislang keine vergleichbaren Darstellungen bekannt sind.
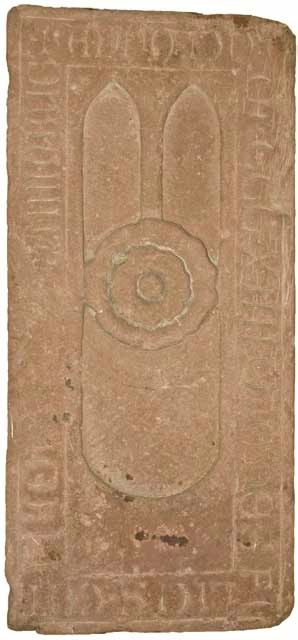
Dieser einzigartige Rosettenschmuck wäre dem Grabstein
beinahe zum Verhängnis geworden. Denn nachdem man ihn zusammen
mit anderen Steindenkmälern aus dem Bereich des Kreuzgangs
des ehemaligen Augustinerklosters, dem heutigen Universitätsplatz,
anno 1912 ausgegraben und lange Jahre in der sogenannten „Trinkstube“,
im Keller des Restaurants Kurpfälzisches Museum, aufbewahrt
hatte, verbrachte man ihn in den sechziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts zu wissenschaftlichen Untersuchungszwecken, nicht
zuletzt wegen der besseren Lesbarkeit und der Anfertigung von
Fotos bei Tageslicht, in den Museumsgarten.
Dort erregte der Stein die Aufmerksamkeit eines interessierten,
aber nicht autorisierten „Denkmalpflegers“ aus Mainz,
der in der Rose ein Geheimzeichen des untergegangenen Templerordens
zu erkennen glaubte und das Kulturgut unter den Augen seiner
Hüter in die Privatbibliothek seines Hauses nach Mainz „in
Sicherheit“ brachte. Bei einer Fernsehsendung 1995, in
der der „Schatzsucher“ in seinem Haus interviewt
wurde, geriet auch der Stein ins Bild. Stadt und Museum setzten
daraufhn alle Hebel in Bewgung, um den Stein an seinen angestammten
Ort zurckzubringen. Seit 1998 ergänzt er wieder im Museum
das Ensemble bemerkenswerter Steinzeugnisse aus der Geschichte
Heidelbergs.
Bild:
Museum (E. Kemmet)
Text (& Textbasis): kmh |