|
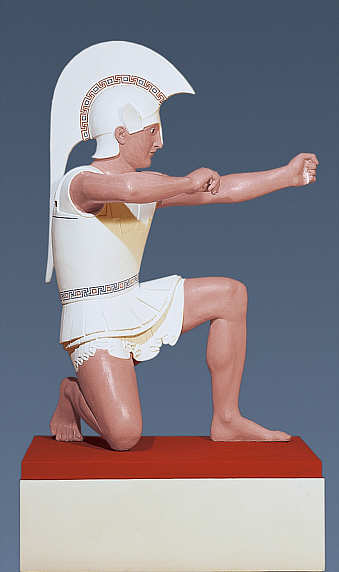 Eigentlich
konnte man es immer schon nachlesen: Die großen Schriftsteller
der griechischen und römischen Antike berichten in
aller Klarheit und Selbstverständlichkeit von den
farbigen Figuren. Der Tragödiendichter Euripides (ca.
480–406 v. Chr.) wählt die farblose Marmorskulptur
als Bild außerordentlicher Hässlichkeit. Als
durch die Schönheit einer Frau der Trojanische Krieg
ausgelöst wird, sagt Helena zu sich: Wäre ich
doch immer so hässlich gewesen wie eine Statue, der
man die Farbe abgewischt hat, wäre nicht dieses Leid über
die Menschen gebracht worden. Dass die Tatsache der „bunten
Antike“ in der Geschichte der Archäologie und
Kunstgeschichte jedoch stark umstritten war, davon zeugen
ebenfalls zahlreiche Quellen. „So wird auch ein schöner
Körper desto schöner sein, je weißer er
ist“, schrieb der berühmte deutsche Archäologe
und Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)
in seiner 1764 erschienenen „Geschichte der Kunst
des Alterthums“ und erhob damit das reine Weiß zum
Schönheitsideal der Antike. Winckelmanns Ansichten
beeinflussten die Kunst des 19. Jahrhunderts und prägen
unsere Vorstellung griechischer und römischer Kunst
bis heute. Dabei konnten bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts
Forscher bei archäologischen Ausgrabungen in Athen
und Rom eindeutige Farbreste an zahlreichen Marmorfiguren
entdecken. Johann Martin von Wagner (1777–1858),
Maler, Bildhauer und Kunstagent des bayerischen Kronprinzen
und späteren Königs Ludwig I., reiste in dessen
Auftrag 1812 nach Griechenland, um dort die kurz zuvor
aufgefundenen Giebelskulpturen des Aphaia-Tempels von Ägina
zu erwerben. 1815/16 verfasste er eine Beschreibung der
farbigen Skulpturen. Allerdings zeigte er sich ganz im
Sinn Winckelmanns eher schockiert und wunderte sich über
den „scheinbar bizarren Geschmack“, den er
als „barbarische Sitte und ein Überbleibsel
aus früheren, rohen Zeiten“ beurteilte. Aber
nicht nur schriftliche Dokumente zeugen von der Farbigkeit
antiker Skulptur. Mit großer Genauigkeit wurden die
Spuren der einstigen Bemalung auch in Zeichnungen und Aquarellen
festgehalten. Ein großer Verdienst kommt hier der
in Griechenland ansässigen Schweizer Künstlerfamilie
Gilliéron zu, die seit ca. 1870 Zeichnungen antiker
Skulpturen anfertigte. Das Liebieghaus besitzt glücklicherweise
eine Reihe von Aquarellen von Emile Gilliéron, die
nun im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden. Überzeugte
Anhänger antiker Polychromie fanden sich auch unter
den Architekten: Gottfried Semper (1803–1879), der
bei einer Reise durch Italien und Griechenland von 1830
bis 1833 selbst Untersuchungen an farbigen Bauten und Skulpturen
vorgenommen hatte, wurde zu einem der bedeutendsten Verfechter
der Polychromie und ließ z. B. die Antikensäle
im Japanischen Palais in Dresden farbig bemalen. Auch Leo
von Klenze (1784–1864) gestaltete unter anderem im
Auftrag seines Bauherrn, König Ludwigs I., die Innenräume
der Glyptothek in München prachtvoll bunt und bezeichnete
sich selbst als „Euer Majestät polychromatischer
Sekretär“. Eigentlich
konnte man es immer schon nachlesen: Die großen Schriftsteller
der griechischen und römischen Antike berichten in
aller Klarheit und Selbstverständlichkeit von den
farbigen Figuren. Der Tragödiendichter Euripides (ca.
480–406 v. Chr.) wählt die farblose Marmorskulptur
als Bild außerordentlicher Hässlichkeit. Als
durch die Schönheit einer Frau der Trojanische Krieg
ausgelöst wird, sagt Helena zu sich: Wäre ich
doch immer so hässlich gewesen wie eine Statue, der
man die Farbe abgewischt hat, wäre nicht dieses Leid über
die Menschen gebracht worden. Dass die Tatsache der „bunten
Antike“ in der Geschichte der Archäologie und
Kunstgeschichte jedoch stark umstritten war, davon zeugen
ebenfalls zahlreiche Quellen. „So wird auch ein schöner
Körper desto schöner sein, je weißer er
ist“, schrieb der berühmte deutsche Archäologe
und Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)
in seiner 1764 erschienenen „Geschichte der Kunst
des Alterthums“ und erhob damit das reine Weiß zum
Schönheitsideal der Antike. Winckelmanns Ansichten
beeinflussten die Kunst des 19. Jahrhunderts und prägen
unsere Vorstellung griechischer und römischer Kunst
bis heute. Dabei konnten bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts
Forscher bei archäologischen Ausgrabungen in Athen
und Rom eindeutige Farbreste an zahlreichen Marmorfiguren
entdecken. Johann Martin von Wagner (1777–1858),
Maler, Bildhauer und Kunstagent des bayerischen Kronprinzen
und späteren Königs Ludwig I., reiste in dessen
Auftrag 1812 nach Griechenland, um dort die kurz zuvor
aufgefundenen Giebelskulpturen des Aphaia-Tempels von Ägina
zu erwerben. 1815/16 verfasste er eine Beschreibung der
farbigen Skulpturen. Allerdings zeigte er sich ganz im
Sinn Winckelmanns eher schockiert und wunderte sich über
den „scheinbar bizarren Geschmack“, den er
als „barbarische Sitte und ein Überbleibsel
aus früheren, rohen Zeiten“ beurteilte. Aber
nicht nur schriftliche Dokumente zeugen von der Farbigkeit
antiker Skulptur. Mit großer Genauigkeit wurden die
Spuren der einstigen Bemalung auch in Zeichnungen und Aquarellen
festgehalten. Ein großer Verdienst kommt hier der
in Griechenland ansässigen Schweizer Künstlerfamilie
Gilliéron zu, die seit ca. 1870 Zeichnungen antiker
Skulpturen anfertigte. Das Liebieghaus besitzt glücklicherweise
eine Reihe von Aquarellen von Emile Gilliéron, die
nun im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden. Überzeugte
Anhänger antiker Polychromie fanden sich auch unter
den Architekten: Gottfried Semper (1803–1879), der
bei einer Reise durch Italien und Griechenland von 1830
bis 1833 selbst Untersuchungen an farbigen Bauten und Skulpturen
vorgenommen hatte, wurde zu einem der bedeutendsten Verfechter
der Polychromie und ließ z. B. die Antikensäle
im Japanischen Palais in Dresden farbig bemalen. Auch Leo
von Klenze (1784–1864) gestaltete unter anderem im
Auftrag seines Bauherrn, König Ludwigs I., die Innenräume
der Glyptothek in München prachtvoll bunt und bezeichnete
sich selbst als „Euer Majestät polychromatischer
Sekretär“.
Bis zum Ausbruch des II. Weltkriegs wurde die Diskussion über
die Farbigkeit der Antike teilweise heftig fortgeführt,
wobei sich im 20. Jahrhundert zunehmend die Schönheit
der reinen und reduzierten Form durchsetzte. Erst in den
1960erJahren begannen Wissenschaftler wieder die Farbigkeit
mit neuen technischen Methoden zu erforschen. Seit über
25 Jahren untersucht und dokumentiert ein internationales
Forscherteam um Prof. Vinzenz Brinkmann mit naturwissenschaftlichen
Techniken die Farbigkeit antiker Skulptur. Wurden vor knapp
200 Jahren die Farbspuren noch mithilfe von Probenentnahmen
analysiert, können heute die meisten Analysen durch
digitale Verfahren erstellt werden. Mit der RamanSpektroskopie
und der UVVisAbsorptionsspektroskopie werden in kurzer
Zeit zahlreiche Pigmentreste bestimmt, ohne das Original
zu berühren. Die neuen Forschungen haben zudem in
großem Umfang von den Möglichkeiten der technischen
Fotografie profitiert, vor allem von der UVFluoreszenzfotografie
und der UVReflektografie, mit der selbst an Stellen, an
denen sich keine Pigmente erhalten haben, die einst aufgemalten
Ornamente aufgrund chemischer und mechanischer Veränderungen
der Steinoberfläche wieder sichtbar gemacht werden
können.
Die Ausstellung im Liebieghaus macht nun anhand von über
30 detailreichen farbigen Rekonstruktionen und 70 ausgewählten
Originalexponaten aus internationalen Sammlungen sowie
aus dem Bestand des Liebieghauses die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Polychromieforschung für den Betrachter sichtbar und
belegt in beeindruckender Weise die Bedeutung der Farbe
für die antike Skulptur.
|