|
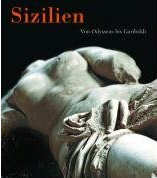 Sizilien
ist eine der mental am weitesten von unserem Begriff von „Europa“ entfernten
Stätten,
und doch auch eine derjenigen, an denen sich Geschichte
auf geradezu aufregende Weise verdichtet. Sikuler, Elymer,
Karthager, Griechen, Römer, Byzantiner, Araber, Normannen
und Spanier haben die Insel geprägt und jeweils ihre
unverwechselbaren Spuren hinterlassen. Diese Geschichte
im Umfang von dreitausend Jahren fasste eine Schau zusammen,
die die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
2008 in Bonn zeigte. Sizilien
ist eine der mental am weitesten von unserem Begriff von „Europa“ entfernten
Stätten,
und doch auch eine derjenigen, an denen sich Geschichte
auf geradezu aufregende Weise verdichtet. Sikuler, Elymer,
Karthager, Griechen, Römer, Byzantiner, Araber, Normannen
und Spanier haben die Insel geprägt und jeweils ihre
unverwechselbaren Spuren hinterlassen. Diese Geschichte
im Umfang von dreitausend Jahren fasste eine Schau zusammen,
die die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
2008 in Bonn zeigte.
Sizilien ist Vielfalt, das betont Giulio Macchi in seiner
Vorrede zu dem Katalog der Ausstellung, der hier besprochen
werden soll. „1001 Sizilien“, das will an 1001
Nacht erinnern, an die wunderbare und wandelbare Welt des
Orients, die auf Sizilien präsenter ist als in anderen
ehemals arabisch-islamisch beeinflussten Regionen.
Sizilien ist seit zweieinhalb Jahrtausenden Kolonie, fremdbestimmt,
ausgebeutet – das betont Macchi, indem er Don Fabrizios
Worte aus Tommaso di Lampedusas Roman „Il Gattopardo“ zitiert.
Und diese Geschichte verlangt nach einem besonderen Blickwinkel,
verbietet es geradezu, nur die Glanzstücke aus Siziliens
herrschaftlicher Kultur zu zeigen. Wer derart geblendet
wird, sieht seinen Blick nur zu schnell verstellt und erkennt
das Wesentliche, das Subtile, das den Charme der Insel
ausmacht, nicht mehr.
Der Katalogband vereinigt nach einem einführenden
Aufsatz über die Insel und ihre Wahrnehmung 13 „Essays“ genannte
Aufsätze über die geschichtliche Entwicklung
von der Prähistorie bis zur Malerei des 19. Jahrhundert
sowie fünf weitere über den „Dämon
der Archäologie“, über Volkskunst, Landschaft,
Pflanzenwelt und Münzgeschichte. Das ist das ganze,
bereits in den einleitenden Worten umrissene Panorama der
geschichtlichen und kulturellen Entwicklung. Die Autoren
sind teils Wissenschaftler von höchsten universitären
Weihen, teils fachkundige und engagierte Kräfte jüngerer
Generationen, was in entscheidendem Maß zur Lesbarkeit
der Artikel auch für den nicht speziell vorgebildeten
Laien beiträgt. In diesen Aufsätzen entsteht
ein schlüssiges und hochdifferenziertes Bild von Politik,
Kultur und Gesellschaft Siziliens.
Durch die zahlreichen hier schon aufgenommenen Illustrationen
umfasst dieser Aufsatzteil fast 200, der nachfolgende Katalog
der Ausstellungsstücke „nur“ um die 150
Seiten. Die Abbildungen sind durchweg von hervorragender
Qualität und in Formaten, die auch Details mühelos
erkennen lassen. Das ist auch der Ort, die Architektur
der jeweiligen Zeit darzustellen, die sich ja der Präsentation
in der Ausstellung entzieht. Die Aufsätze selbst gehen – alles
andere wäre verwunderlich – weniger ereignisgeschichtlich
als vielmehr ideen- und kulturgeschichtlich vor, stellen
auf dem neuesten Stadt der Forschung far, was war, was
wuchs und was sich unter welchen Einflüssen formte.
So erläutert der Aufsatz „Sizilien zur Zeit
der Griechen: ‚Brot und Wein’“ (Dieter
Mertens und Magdalena Mertens-Horn) detailliert, warum
sizilische Griechenstädte grundlegend anders sind
als solche im griechischen Mutterland. Man darf gespannt
sein, wann solche Erkenntnisse Eingang in die historischen
Kapitel gängiger Reiseführer finden. Didaktisch
aufgebaut auch der Aufsatz über „Christliche
und byzantinische Kultur auf Sizilien“ (Rosa Maria
Bonasca Carra). Er zeigt an einzelnen Fundstücken
und Fundkomplexen auf, welch differenzierte Aussagen über
die Zeit der christlichen Spätantike getroffen werden
können. Der Artikel über das Mittelalter auf
Sizilien (Gerhard Wolf und Henrike Haug) zeigt auf, wie
sehr z.B. das arabische Element von den Normannenkönigen
als Mittel zur Inszenierung ihrer Monarchie benutzt und
eingesetzt wurde.
 Es ist hier nicht der Ort, die Stücke hervorzuheben, die
die Ausstellung als Perlen der sizilianischen Kultur präsentierte.
Eines zu nennen hieße, die anderen herabzuwürdigen. Es ist hier nicht der Ort, die Stücke hervorzuheben, die
die Ausstellung als Perlen der sizilianischen Kultur präsentierte.
Eines zu nennen hieße, die anderen herabzuwürdigen.
Am
Katalogteil ist zu loben, dass alle Stücke
abgebildet sind – allerdings auch die, die vorher
im Aufsatzteil schon wiedergegeben wurden. Vielleicht hätte
man bei einem solch grundlegenden und erstklassig ausgestatteten
Band auch im Katalogtext auf die größerformatigen
Bilder in den Aufsätzen verweisen können. Die
einzelnen Stücke sind beschrieben, erläutert
und mit Literaturangaben versehen. Das macht den Band zu
einem grundlegenden Kompendium über Kunst und Kultur
Siziliens und gibt ihm in Punkto Nachhaltigkeit die Bestnote.
|