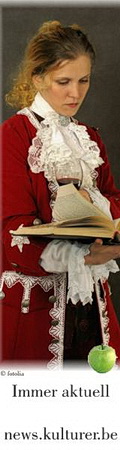Projekt kulturer.be
Nachrichten & Notizen aus dem Kulturerbe
20.7.18
Goldene Zeiten: Sonderausstellung „Bayerns Gold“ auf der Kaiserburg Nürnberg
Ausstellung der Bayerischen Schlösserverwaltung vom 6. Juli bis zum 14. Oktober
(bsv) Vom 6. Juli bis zum 14. Oktober präsentiert die Bayerische Schlösserverwaltung die Sonderausstellung „Bayerns Gold“ im Rittersaal auf der Kaiserburg Nürnberg. Welcher Ort eignet sich dafür besser als die Nürnberger Kaiserburg? In Nürnberg wurden einst die wertvollen Reichkleinodien des Heiligen Römischen Reichs aufbewahrt. Die Reichsstadt war ein bedeutendes Zentrum der Goldschmiedekunst. Im mittelfränkischen Roth entstanden feine Goldgespinste, im nahegelegenen Schwabach wird bis heute das Goldschlägerhandwerk gelebt. Im Palas der Kaiserburg, stilecht in einem begehbaren Goldbarren inszeniert, wird die Geschichte von „Bayerns Gold“ in fünf Themenbereichen erzählt. Rund 80 wertvolle Originalexponate berichten von der Goldgewinnung, der Goldverarbeitung und dem Goldhandel in Bayern. Kostbare Kleinode, wie etwa ein in Nürnberg geprägter Lorenzgulden oder ein filigran gearbeitetes Dornenreliquiar warten auf ihre Entdeckung.
 Auch ein wichtiger Neuankauf der Bayerischen Schlösserverwaltung wird in der Sonderausstellung erstmals ausgestellt, ein Präsentationsentwurf für das Monumentalgemälde „Die Einbringung der Reichskleinodien 1424 in Nürnberg“ (1881) des bedeutenden Nürnberger Architekturmalers Paul Ritter (1829-1907, Bild links: Foto Bayerische Schlösserverwaltung, München). Geschildert wird der Augenblick, in dem der Zug der Nürnberger Abgesandten mit den zur Aufbewahrung anvertrauten Reichskleinodien am 22. März 1424 den Platz der Frauenkirche erreicht. Bei diesem 40 x 47 cm großen Ölgemälde handelt es sich um einen Entwurf für die Stadt Nürnberg, der wohl den städtischen Kollegien 1881 zur Zustimmung vorgelegt wurde. Das anschließend ausgeführte, sich heute im Besitz der Stadt Nürnberg befindende Monumentalgemälde wurde am 22. März 1883 von Kaiser Wilhelm I. im Nürnberger Rathaus feierlich enthüllt, schließlich war die Rolle Nürnbergs als Hüterin der Insignien der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Ausdruck seiner früheren Größe und Bedeutung. Das nun erworbene Bild wurde im Restaurierungszentrum der Bayerischen Schlösserverwaltung restauriert und wird auch nach der Ausstellung „Bayerns Gold“ in der Kaiserburg präsentiert werden.
Auch ein wichtiger Neuankauf der Bayerischen Schlösserverwaltung wird in der Sonderausstellung erstmals ausgestellt, ein Präsentationsentwurf für das Monumentalgemälde „Die Einbringung der Reichskleinodien 1424 in Nürnberg“ (1881) des bedeutenden Nürnberger Architekturmalers Paul Ritter (1829-1907, Bild links: Foto Bayerische Schlösserverwaltung, München). Geschildert wird der Augenblick, in dem der Zug der Nürnberger Abgesandten mit den zur Aufbewahrung anvertrauten Reichskleinodien am 22. März 1424 den Platz der Frauenkirche erreicht. Bei diesem 40 x 47 cm großen Ölgemälde handelt es sich um einen Entwurf für die Stadt Nürnberg, der wohl den städtischen Kollegien 1881 zur Zustimmung vorgelegt wurde. Das anschließend ausgeführte, sich heute im Besitz der Stadt Nürnberg befindende Monumentalgemälde wurde am 22. März 1883 von Kaiser Wilhelm I. im Nürnberger Rathaus feierlich enthüllt, schließlich war die Rolle Nürnbergs als Hüterin der Insignien der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Ausdruck seiner früheren Größe und Bedeutung. Das nun erworbene Bild wurde im Restaurierungszentrum der Bayerischen Schlösserverwaltung restauriert und wird auch nach der Ausstellung „Bayerns Gold“ in der Kaiserburg präsentiert werden.
Goldgewinnung in Bayern
Nach Aventin, dem ersten Geschichtsschreiber Bayerns, beruhte der Reichtum des Landes auf seinen fruchtbaren Wäldern, Gewässern und Fluren mit ihrem reichen Ertrag an Wild, Fisch und Getreide. Aventin erwähnt eigens auch das in der Gegend um Reichenhall gewonnene Salz, das als „weißes Gold“ für den Reichtum der Wittelsbacher Herzöge ausschlaggebend war. Doch Bayern besitzt sogar echtes Gold: Berggold im Norden (Fichtelgebirge, Frankenwald, Oberpfälzer und Bayerischer Wald) und Flussgold im Süden (v. a. Isar, Inn und Donau). Seit dem 14. Jahrhundert entwickelte sich das am Fuß des Fichtelgebirges gelegene Goldkronach, in dem noch bis 1925 Gold abgebaut wurde, zum Zentrum des Goldbergbaus. Flussgold gewannen dagegen bereits die Kelten. Die Hochzeit des Goldwaschens war im 18. Jahrhundert. Im Jahr 1756 ließ der bayerische Kurfürst die ersten „Flussgolddukaten“ aus dem Gold der Flüsse Isar, Inn und Donau prägen. Die Münzen dienten nicht als Zahlungsmittel, sondern waren Medaillen mit Erinnerungswert.
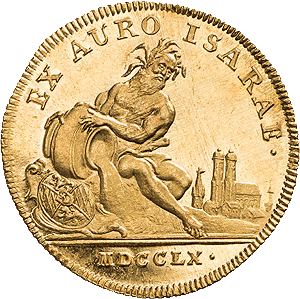

 Isargolddukaten, 1760.
Staatliche Münzsammlung, München
Isargolddukaten, 1760.
Staatliche Münzsammlung, München
Foto © Staatliche Münzsammlung, München / Nicolai Kästner
Spule mit Goldgespinst. Fabrikmuseum, Roth
Dornenreliquiar in Form eines Deckelpokals, um 1500
Bayerische Schlösserverwaltung, Würzburg
Gold im Handel
Wertstabile Goldmünzen waren bei den Kaufleuten im Spätmittelalter begehrt und ermöglichten den kapitalintensiven Groß- und Fernhandel der Städte Regensburg, Nürnberg und Augsburg. Zunächst wurden Goldmünzen nur in Böhmen und Ungarn geprägt. Der „Sebaldusgulden“ und der „Lorenzgulden“ gehören zu den ersten Goldgulden, welche die Reichsstadt Nürnberg nach dem Großen Münzprivileg von 1422 prägen durfte.
Gold als höchste Auszeichnung
Gold ist Zeichen höchster Macht und Würde sowohl im sakralen als auch profanen Bereich. Nürnberg und Augsburg waren in der frühen Neuzeit und im Spätmittelalter die wichtigsten Zentren der Goldschmiedekunst. Die Kunstwerke basierten oft auf Entwürfen bedeutender Künstler und wurden wegen ihrer handwerklich-technischen Feinheit und ihrer großen Formenvielfalt in ganz Europa bewundert. Exemplarisch für den symbolischen Wert von Gold zeigt die Ausstellung hochrangige Kunstwerke, wie das „Dornenreliquiar in Form eines Deckelpokals“ (eine Nürnberger Goldschmiedearbeit um 1500, von der Festung Marienberg in Würzburg) oder den „Aufsatz für beide Münchner Krönungswagen“ aus dem Jahr 1813 (eine Leihgabe des Wittelsbacher Ausgleichsfonds aus dem Marstallmuseum in Nymphenburg).
Von Blattgold und Goldgespinst
Goldene Gegenstände sind selten aus massivem Gold, sondern aus härterem oder weniger wertvollem Material wie Silber oder Messing, welches dann vergoldet wurde. Eine Form der Vergoldung ist das Auftragen von hauchdünnem geschlagenem Gold, dem Blattgold. Schwabach, wo das Handwerk noch heute heimisch ist, wurde zum Zentrum des Goldschlägerhandwerks in Bayern. Auch in der Textilkunst signalisierte Gold Reichtum und Macht. Mithilfe von sogenanntem Goldgespinst konnte man Gewebe herstellen, die aussahen wie echtes Gold, größtenteils aber aus Kupfer bestanden. Die Technik kam im 16. Jahrhundert mit den Hugenotten nach Franken. Dort entwickelte sich in Roth ein ganzer Industriezweig zur Herstellung der Drahtprodukte, die nach dem Herkunftsort Lyon als „Leonische Waren“ bezeichnet werden.
Sagenhaftes Gold
Die fürstlichen Höfe der Renaissance und des Barock waren wegen ihrer aufwendigen Hofhaltung und teuren Kriege häufig in Geldnot. Abhilfe schaffen sollte die Alchemie, die versprach, unedle Metalle in Gold oder Silber zu verwandeln. Dies zog betrügerische „Goldmacher“ an, von deren oft unrühmlichem Ende die Ausstellung erzählt. Die Experimente der wahren Alchemisten zeitigten zwar ebenfalls kein Gold, aber viele wichtige chemische Erfindungen wie die des europäischen Porzellans, des neuen weißen Goldes.
Die Kaiserburg Nürnberg
Die Nürnberger Burg war im Mittelalter eine der bedeutendsten Kaiserpfalzen des Heiligen Römischen Reichs. Über älteren Bauten aus der Zeit der Salier errichteten die Staufer und ihre Nachfolger eine große Burganlage, zu deren ältesten erhaltenen Teilen die kaiserliche Doppelkapelle (um 1200) gehört.
Die kaiserlichen Wohn- und Repräsentationsräume im Palas verfügen teilweise noch über Vertäfelungen aus Spätmittelalter und Renaissance. Berühmt ist auch der Tiefe Brunnen, der in Zeiten der Belagerung die wichtigste Wasserquelle der Burg bildete. Die älteste Nachricht über ihn stammt aus dem 14. Jahrhundert, doch ist er vermutlich so alt wie die Kaiserburg selbst. Der Wehrturm im Vorhof der Kaiserburg, der sog. Sinwellturm, wurde im 13. Jahrhundert errichtet und bietet einen herrlichen Rundblick über Nürnbergs Altstadt. Im Sinwellturm ist außerdem eine Ausstellung mit Fotografien zur Zerstörung von Burg und Stadt im Zweiten Weltkrieg zu sehen.
Die Sonderausstellung „Bayerns Gold“ ist vom 6. Juli bis zum 3. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr, vom 4. bis 14. Oktober 2018 täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
Der Eintrittspreis ist in der Eintrittskarte für den Rundgang durch Palas und Kemenate inbegriffen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen keinen Eintritt. Erwachsene zahlen 5,50 Euro regulär/4,50 Euro ermäßigt für den Palas mit Doppelkapelle und das Kaiserburgmuseum.
Die Gesamtkarte "Kaiserburg" (Palas mit Doppelkapelle + Tiefer Brunnen + Sinwellturm + Kaiserburg-Museum) kostet 7,- Euro regulär · ermäßigt 6,- Euro.
Informationen zur Kaiserburg Nürnberg finden Sie unter: ![]() www.kaiserburg-nuernberg.de
www.kaiserburg-nuernberg.de
| im Detail: | |
| siehe auch: |
Startseite | Service | zur
ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2018
© Texte der Veranstalter, ohne Gewähr