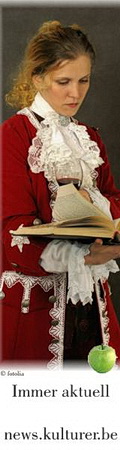Projekt kulturer.be
Nachrichten & Notizen aus dem Kulturerbe
19.5.17
Heidelberg und der Heilige Stuhl - von den Reformkonzilien des Mittelalters zur Reformation
Päpste – Kurfürsten – Professoren – Reformatoren
(kmh) 2013 fand in Heidelberg die große Ausstellung „Macht des Glaubens“ statt, die sich mit dem Heidelberger Katechismus und seiner Wirkungsgeschichte beschäftigte und internationale Aufmerksamkeit erregte. 2017, anlässlich des Reformationsjubiläums, bietet sich nun die Gelegenheit, die Vorgeschichte dieser glaubensgeschichtlich bedeutenden Epoche aufzuzeigen. Mit faszinierenden Exponaten – darunter zum Teil noch nie gezeigten Zeugnissen zur spektakulären Gefangennahme des (Gegen-)Papstes Johannes XXIII. durch Pfalzgraf Ludwig III. und zu seiner Festsetzung in Heidelberg und Mannheim - thematisiert die Heidelberger Ausstellung die kirchlichen Umwälzungen zwischen ausgehendem Mittelalter und Renaissance, welche schließlich in die Reformation mündeten.
 Auch zu dieser Zeit gab es bereits Reformversuche, die die Zeit nach 1517 maßgeblich beeinflussten und die Jan Hus und Hieronymus von Prag auf dem Konstanzer Konzil mit dem Leben bezahlen mussten. Die weitere Entwicklung der Reformation von der Heidelberger Disputation Luthers 1518 bis zum Heidelberger Katechismus 1563 kann am Beispiel der kurpfälzischen Residenz- und Universitätsstadt besonders eindrucksvoll verfolgt werden. Die Ausstellung greift die Entwicklungen des Mittelalters auf, welche jenem Ereignis vorausgingen. Zu nennen sind dabei Phänomene wie die europaweite Spaltung der mittelalterlichen Kirche im Großen Abendländischen Schisma, das Ringen um Einheit der Kirche auf den Konzilien, jenen Drehscheiben internationaler Beziehungen, auf denen unter maßgeblicher Beteiligung vieler europäischer Universitäten und den auf ihnen vertretenen ‚Nationen‘ Reformansätze diskutiert wurden. Später monierte Luther selbst, dass eine Reform, wie sie gerade von den Deutschen gefordert wurde, nicht zustande kam: Sie haben bis her inn den Conciliis nichts gethan […].
Auch zu dieser Zeit gab es bereits Reformversuche, die die Zeit nach 1517 maßgeblich beeinflussten und die Jan Hus und Hieronymus von Prag auf dem Konstanzer Konzil mit dem Leben bezahlen mussten. Die weitere Entwicklung der Reformation von der Heidelberger Disputation Luthers 1518 bis zum Heidelberger Katechismus 1563 kann am Beispiel der kurpfälzischen Residenz- und Universitätsstadt besonders eindrucksvoll verfolgt werden. Die Ausstellung greift die Entwicklungen des Mittelalters auf, welche jenem Ereignis vorausgingen. Zu nennen sind dabei Phänomene wie die europaweite Spaltung der mittelalterlichen Kirche im Großen Abendländischen Schisma, das Ringen um Einheit der Kirche auf den Konzilien, jenen Drehscheiben internationaler Beziehungen, auf denen unter maßgeblicher Beteiligung vieler europäischer Universitäten und den auf ihnen vertretenen ‚Nationen‘ Reformansätze diskutiert wurden. Später monierte Luther selbst, dass eine Reform, wie sie gerade von den Deutschen gefordert wurde, nicht zustande kam: Sie haben bis her inn den Conciliis nichts gethan […].
Chronik des Ulrich von Richental: Der Sturz des Papstes Johannes XXIII. auf der Fahrt über die Alpen zum Konstanzer Konzil.
Die Einheit der lateinischen Welt war insbesondere nach dem Ausbruch des Großen Abendländischen Schismas im Jahre 1378 mit der Existenz von zwei, mitunter sogar drei gleichzeitigen Päpsten gefährdet. Eine Lösung sollte das berühmte Konstanzer Konzil herbeiführen. 1414 begonnen, mündete es 1417 – also vor genau 600 Jahren – nach der Absetzung konkurrierender Päpste tatsächlich in der Wahl eines neuen Pontifex. Die so kurzzeitig wiederhergestellte Einheit war jedoch nur ein Ziel des Konzils. Darüber hinaus standen die causa reformationis, womit Reformen innerkirchlicher Zustände gemeint waren, und die causa fidei, also die Bekämpfung von Ketzerei, im Zentrum der Beratungen.
 Eine päpstliche Urkunde bildet den Ursprung dieser Ausstellung. Es handelt sich um ein päpstliches Residenzprivileg aus dem Jahre 1387, das in diesem Jahr also genau 630 Jahre alt wird. Nachdem die Urkunde zusammen mit weiteren Archivalien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschollen war, kehrte sie 2014 aus dem unfreiwilligen Exil von einem Dachboden in den USA wieder in das Heidelberger Universitätsarchiv zurück und erzeugte dabei ein so großes Medienecho, dass anhand ihrer Odyssee im abschließenden Teil auch der Wert von historischer Überlieferung und die Wichtigkeit ihrer Bewahrung in Archiven vor Augen geführt werden kann.
Eine päpstliche Urkunde bildet den Ursprung dieser Ausstellung. Es handelt sich um ein päpstliches Residenzprivileg aus dem Jahre 1387, das in diesem Jahr also genau 630 Jahre alt wird. Nachdem die Urkunde zusammen mit weiteren Archivalien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschollen war, kehrte sie 2014 aus dem unfreiwilligen Exil von einem Dachboden in den USA wieder in das Heidelberger Universitätsarchiv zurück und erzeugte dabei ein so großes Medienecho, dass anhand ihrer Odyssee im abschließenden Teil auch der Wert von historischer Überlieferung und die Wichtigkeit ihrer Bewahrung in Archiven vor Augen geführt werden kann.
Rechts: Chronik des Ulrich von Richental: Kurfürst Ludwig III. von der Pfalz führt den tschechischen Gelehrten und Reformator Hieronymus ("von Prag") zur Verbrennung als Ketzer (1415).
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit rund 95 Abb. zum Preis von € 14,-.
Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Themenführungen, Vorträgen, Konzerten und einer Podiumsdiskussion komplettiert die Ausstellung.
Eine Ausstellung des Historischen Vereins zur Förderung der internationalen Calvinismusforschung e.V., des Kurpfälzischen Museums und des Universitätsarchivs Heidelberg, mit Unterstützung des Freundeskreises für Archiv und Museum der Universität Heidelberg e.V., gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
21. Mai bis 22. Oktober 2017
Kurpfälzisches Museum der Stadt Heidelberg
Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg
Tel.: 06221 / 58 34 020, Fax 06221 / 58 34 900
Di – So 10 bis 18 Uhr, Mo geschlossen
Der Eintritt in die Dauerausstellung (Euro 3,- / erm. Euro 1,80) beinhaltet den Eintritt in die Sonderausstellung „Heidelberg und der Heilige Stuhl“.
![]() www.museum-heidelberg.de
www.museum-heidelberg.de
| im Detail: | |
| siehe auch: |
Startseite | Service | zur
ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2017
© Texte der Veranstalter, ohne Gewähr