|
Mit der umfangreichen Antikenausstellung „Zurück
zur Klassik“ öffnet die Liebieghaus Skulpturensammlung
vom 8. Februar bis 26. Mai 2013 einen neuen Blick auf das alte
Griechenland. Anhand von rund 80 herausragenden Werken, darunter
Bronzeskulpturen, Vasen, Malereien, Terrakotten sowie bemalte,
figürliche
Gefäße bietet das groß angelegte Ausstellungs- und Forschungsprojekt
einen neuen Zugang zur Kunst- und Kulturgeschichte der griechischen Klassik im
5. und 4. Jahrhundert vor Christus. Zusammen mit eigens für die Ausstellung
entwickelten Rekonstruktionen führen die Arbeiten den ungeheuren ästhetischen
und intellektuellen Innovationsschub jener Zeit vor Augen.
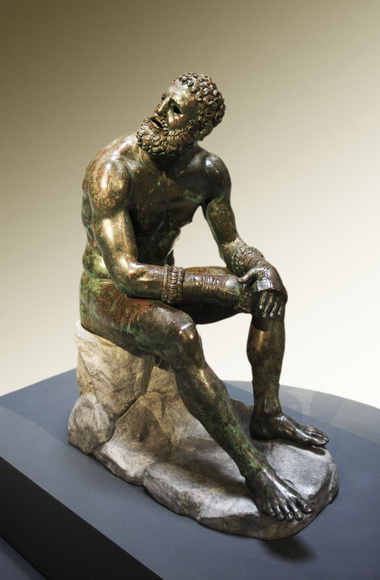 Bild:
Statue eines Faustkämpfers, aus Rom (Quirinal), Bronze,
2. Hälfte des 4. Jh. v. Chr. oder 3. Jh.
v. Chr. Bild:
Statue eines Faustkämpfers, aus Rom (Quirinal), Bronze,
2. Hälfte des 4. Jh. v. Chr. oder 3. Jh.
v. Chr.
Bronze
Museo Nazionale Romano, Rom
Foto: akg-images / Jürgen Raible
Von der griechischen Klassik
geht eine außerordentliche
Wirkung auf die europäische Kultur aus, gilt sie bis heute
als Grundlage einer gemeinsamen europäischen Werte- und
Kulturgemeinschaft. Die Wahrnehmung dieser bereits über
2500 Jahre zurückliegenden Epoche ist jedoch stark eingeschränkt
und vielfach verfremdet: Nicht nur ist ein bedeutender Teil der
originalen Kunstwerke und des Schrifttums unwiederbringlich verloren, überdies
verstellen römische Kopien und die wiederholte klassizistische
Rezeption oftmals den Blick auf das Erhaltene. Zur Frankfurter Ausstellung bieten originale Meisterwerke der
griechischen Bronzeplastik und Malerei – darunter spektakuläre
Neufunde aus Porticello und Brindisi – ein anderes, unverfälschtes
Bild der klassischen Kunst. Neben zahlreichen Leihgaben aus internationalen
Sammlungen, u. a. in Berlin, London, New York, Paris, Rom und
St. Petersburg, lassen die unter Berücksichtigung neuester
wissenschaftlicher und technologischer Aspekte entwickelten Rekonstruktionen
eines Riace-Kriegers sowie des Jagdfreskos von Vergina das ursprüngliche
Aussehen weltberühmter Originale wiedererstehen. Zur Ausstellung
erscheint ein umfassender Katalog, der einen differenzierten Überblick
der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur griechischen
Klassik bietet.
Die griechische Kunst der sogenannten klassischen Zeit entwickelte
ein völlig neues Menschenbild.
Insbesondere die ersten 50 Jahre dieser Phase dürfen als außerordentlich
avantgardistisch gelten, weshalb für diese relativ kurze Zeitspanne
zwischen dem Ende der Perserkriege (480/79 v. Chr.) bis zum Ausbruch
des Peloponnesischen Krieges (431 v. Chr.) bereits in der antiken
Literatur ein eigener Begriff geprägt wurde: Pentekontaetie.
Die Maler und Bildhauer dieser Epoche erreichten in wenigen Generationen
eine gänzlich neue Sicht auf den Menschen. Auch die Spiegelung
irdischer Konflikte und lebensweltlicher Zusammenhänge in
die Sphäre des Göttlichen erfuhr hier eine nachhaltige
Ausformung. In später nie wieder erreichter Differenzierung
und intellektueller Dialektik wird der Mensch ins Bild gesetzt.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden das Auge
und die Stimmung des Betrachters vollständig gefangen genommen.
Die Figur bewegt sich frei im Raum, die Maler entwickelten den
gänzlichen Satz der illusionistischen Stilmittel. Bis zur
italienischen Renaissance sollte dieser Grad an Raffinesse und
innere Spannung nicht wieder erreicht werden.
 Kopf
des Apollon Sauroktonos des Praxiteles, aus derSammlung Chigi,
späthellenistische Kopie (vor der Mitte des 1. Jhds v. Chr.)
nach einem Vorbild um 350 v. Chr. Marmor Kopf
des Apollon Sauroktonos des Praxiteles, aus derSammlung Chigi,
späthellenistische Kopie (vor der Mitte des 1. Jhds v. Chr.)
nach einem Vorbild um 350 v. Chr. Marmor
Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung, Dresden
Foto: H.-P. Klut / E. Estel
© Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung, Dresden
Der heutige Blick auf das klassische Griechenland des 5. Jh.
v. Chr. ist verstellt durch die verschiedenen Stufen und Phasen
der
Deutung und der vermeintlichen Aneignung des „Klassischen“:
Der kulturpropagandistische Kampf des perikleischen Zeitalters,
aber auch die zahlreichen folgenden, zum Teil verheerenden Selektionen
in Klassizismen, christlich-ethischen oder bürgerlich-moralischen Überformungen
sowie zahlreiche Kopien haben das Bild der Klassik verfälscht.
Besonders tragisch ist in diesem Zusammenhang auch der enorme Verlust
originaler klassischer Werke durch natürlichen Verfall wie
auch durch mutwillige Zerstörung. Es ist als eine Befreiung
von dieser Sicht auf das 5. Jh. und auch das 4. Jh. v. Chr. zu
werten, dass in den letzten 40 Jahren originale Bronzeskulpturen
von unerhörter Schönheit und formaler Kraft aus den Meeren
geborgen werden konnten. Arbeiten wie das „Porträt eines
Philosophen“ aus Süditalien oder der „Kopf eines
Afrikaners“ aus der Kyrenaika geben in der Ausstellung einen
Eindruck von der Virtuosität der „wahren“ bzw. „echten“ Klassik.
Das Ziel der Frankfurter Ausstellung ist es, die Klassik aus ihren
Deutungen und Verunklärungen zu lösen und so den Zugang
zur „anderen“ Klassik im gesamten Zusammenhang freizulegen.
Neben einer Vermittlung grundlegender Einsichten in die Formgebung
und Wirkung originaler Bronzeplastik und Malerei der griechischen
Klassik möchte die Ausstellung über ideologisch und ästhetisch
bedingte Perspektiven aufklären und so einen Beitrag leisten
zu einem Verständnis der klassischen Epoche, die dieser Kultur
in ihren Zeugnissen und Äußerungen gerecht wird.
Die Struktur der Ausstellung basiert auf zwei zentralen Aspekten.
Ausgehend von der Gegenwart durchläuft der Besucher im ersten
Teil eine Zeitreise durch die verschiedensten Klassizismen, indem
er immer weiter zum eigentlichen Kern der Klassik ins 4. und
5. Jh. v. Chr. vordringt. Dieser erste Abschnitt ist als begehbare
Wandzeitung mit Texten, Bildern und Zitaten konzipiert und wird
durch Objekte und Kunstwerke der verschiedenen Epochen strukturiert.
Im Mittelpunkt des zweiten Themenkomplexes steht die Präsentation
spektakulärer Neufunde, anhand derer die Ausdruckskraft originaler
klassischer Werke erlebbar wird. Der Fokus liegt hierbei hauptsächlich
auf der originalen griechischen Bronzeplastik in ihrer außerordentlichen
formalen und erzählerischen Vielfältigkeit, darunter
Höhepunkte wie der „Faustkämpfer vom Quirinal“ und
das bronzene „Kapitolinische Pferd“ aus Rom. Die Marmorskulpturen,
insbesondere die nachklassischen antiken Kopien, werden in einem
räumlich separierten Teil der Ausstellung aus der nachklassischen
Zeit gezeigt, sodass schon die ersten Schritte hin zu einer Verfremdung
von Originalen nachvollziehbar werden. Am Beispiel der berühmten
Sauroktonos-Statue des Praxiteles wird dieser Prozess besonders
anschaulich.
Neben der griechischen Bronzeplastik versucht die Antikenausstellung,
die Einzigartigkeit der klassischen Malerei sichtbar zu machen.
In den vergangenen vier Jahrzehnten sind zahlreiche Wandmalereien
in makedonischen Gräbern entdeckt worden, die einen ungetrübten
Blick auf originale griechische Malerei eröffnen. Für
die Frankfurter Ausstellung wurde darum in Kooperation mit griechischen
Wissenschaftlern der Aristoteles-Universität in Thessaloniki
eine präzise restauratorische Rekonstruktion eines Jagdfrieses
von der Grabfassade des sogenannten Philippsgrabs in Vergina (um
320 v. Chr.) angefertigt. Gemeinsam mit ebenfalls in der Ausstellung
präsentierten qualitätvollen Gemälden auf großformatigen
Grabgefäßen verdeutlicht das Jagdfries eindrucksvoll
die künstlerische und intellektuelle Raffinesse dieser Malerei – der
in der Antike am höchsten geschätzten Kunstgattung.
 Partielle
Rekonstruktion des Bronzekriegers A aus Riace (Kalabrien).
Bronzeguss nach einem hochauflösenden Scan des Originals Partielle
Rekonstruktion des Bronzekriegers A aus Riace (Kalabrien).
Bronzeguss nach einem hochauflösenden Scan des Originals
Bronze, farbige Steine, Kupfer, Silber, Asphaltlack.
Foto: Norbert Miguletz
© Liebieghaus Skulpturensammlung
Seit der Auffindung der Riace-Bronzen 1972 vor der Küste Kalabriens
wurden mehrere breit angelegte technisch-wissenschaftliche Untersuchungen
durchgeführt, die bemerkenswerte Erkenntnisse zu den antiken
Arbeitstechniken erbracht haben. Diese sind in die aufwendigen
Rekonstruktionen des Liebieghauses eingeflossen. Auch im Bereich
der Bronzeplastik stellen die aufwendigen Rekonstruktionen einen
wichtigen Aspekt des Ausstellungskonzepts dar. Im Zuge eines wissenschaftlichen
Experiments zu den komplexen Verfahren des antiken Bronzegusses
ist im Vorfeld der Ausstellung und auf Basis eines digitalen Feinscans
ein authentischer Nachguss vom Kopf eines Kriegers entstanden.
Die Rekonstruktion der berühmten Statue des Riace-Kriegers
A (460–450 v. Chr., Museo Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria) führt das ursprüngliche Aussehen der Großbronze
ebenso deutlich vor Augen wie die technischen Aspekte ihrer Herstellung.
Das von Edilberto Formigli, Spezialist für antike griechische
Bronzetechnologie, durchgeführte archäologische Experiment
umfasst insbesondere die Ergänzung der fehlenden Eingelearbeiten
wie die Augen oder Zähne des Kriegers sowie die Wiedergewinnung
der künstlichen Patina. Die Konzeption der von Vinzenz Brinkmann kuratierten Ausstellung
wurde von einem auserlesenen wissenschaftlichen Komitee begleitet.
Mitglieder sind Salvatore Settis, ehemaliger Direktor der Scuola
Normale Superiore di Pisa, Hans-Joachim Gehrke, ehemaliger Präsident
des Deutschen Archäologischen Instituts, Oliver Primavesi,
Leibnizpreisträger und Wiederentdecker der Philosophie des
5. Jh. v. Chr.,
Claudio Parisi Presicce, Direktor der Kapitolinischen Museen,
sowie Wulf Raeck, Ausgräber des klassischen Priene. Sie alle haben
zusammen mit ihren Schülern bedeutende Forschungsarbeiten
im Themenfeld des Projekts geleistet. In ihren Beiträgen zu
dem umfassenden Katalog der Ausstellung präsentieren sie die
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Bereichen Archäologie,
Alte Geschichte und Klassische Philologie.
 Pier
Jacopo Alari Bonacolsi, gen. Antico (um 1460–1528),
Apoll vom Belvedere, Mantua, 1497/1498.
Teilvergoldete Bronze, Augen in Silber eingelegt, bez. am Pier
Jacopo Alari Bonacolsi, gen. Antico (um 1460–1528),
Apoll vom Belvedere, Mantua, 1497/1498.
Teilvergoldete Bronze, Augen in Silber eingelegt, bez. am
Köcher: ANT, H 41,3 cm
Frankfurt am Main, Liebieghaus Skulpturensammlung
Kurator: Prof. Dr. Vinzenz Brinkmann (Liebieghaus Skulpturensammlung)
Wissenschaftliche Mitarbeit und Projektleitung: Salvatore Mancuso Katalog: Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog
im Hirmer Verlag, herausgegeben von Vinzenz Brinkmann, mit
Beiträgen
von E. Formigli, H.-J. Gehrke, C. Parisi Presicce, O. Primavesi,
W. Raeck, S. Settis und A. Stewart. Dt. Ausgabe, ca. 380 Seiten,
ca. 550 Abbildungen, 39,80 € (Museumsausgabe).
Weitere Publikationen: Zur Ausstellung erscheint ein Begleitheft
(ab 12 Jahren), 7,50 Euro.
Audiotour: Durch die Ausstellung führt eine Audiotour (deutsch),
4 Euro.
Öffentliche Führung in der Ausstellung: mittwochs 19.30 Uhr,
samstags 16.00 Uhr, sonntags 15.00 Uhr
Ort: Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, 60596
Frankfurt am Main
Öffnungszeiten: Di, Fr–So 10.00–18.00 Uhr, Mi und Do
10.00–21.00 Uhr, Montag geschlossen
Information:  www.liebieghaus.de, www.liebieghaus.de,  info@liebieghaus.de, Telefon:
+49(0)69-650049-0 info@liebieghaus.de, Telefon:
+49(0)69-650049-0
Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, Familienticket 16
Euro, freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre

Attische Statuette des Papposilen mit Dionysosknaben, aus der
Sammlung Furtwängler, frühes 4. Jahrhundert v. Chr.
Terrakotta, H 11,1 cm, aus vielen Fragmenten zusammengesetzt;
hergestellt aus mehreren Matrizen; teilweise durch
Brand geschwärzt.
Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt am Main

Statuette eines Philosophen, spätes 2. Jh. v. Chr. oder
1. Jh. v. Chr. Bronze,
The Metropolitan Museum of Art, New York.
Foto: Norbert Miguletz
|