|
15. August 1961: Zwei Tage nach dem Beginn des
Mauerbaus springt der 19-jährige DDR-Bereitschaftspolizist Conrad
Schumann an der Bernauer Straße in Berlin über
den provisorisch ausgerollten Stacheldraht in den Westen.
Bildikonen wie dieser „Sprung in die Freiheit“,
die Hissung der Sowjetflagge auf dem Reichstag 1945, der
symbolische Händedruck zwischen den Parteiführern
Pieck (KPD) und Grotewohl (SPD) auf dem Gründungsparteitag
der SED 1946 oder der Kniefall von Willy Brandt in Warschau
1970 haben sich als Schlüsselbilder in das kollektive
Gedächtnis der Deutschen in Ost und West eingebrannt
und prägen das Geschichtsbewusstsein der Nation.
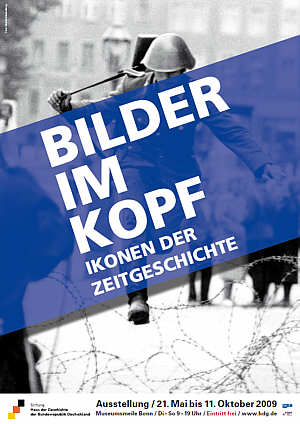 Anlässlich des 60. Geburtstages der Bundesrepublik
Deutschland und 20 Jahren Mauerfall zeigt die Stiftung
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom
21. Mai – 11. Oktober 2009 die Ausstellung „Bilder
im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte“. Sie analysiert
die Entstehung, Verbreitung und Wirkkraft politischer Bilder
aus der Zeit des Nationalsozialismus, der DDR und der Bundesrepublik
Deutschland. Neben den Original-Fotografien wird auch deren
Verbreitung in Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten,
Büchern und anderen Publikationen sowie deren künstlerische
Adaption in Werken der Bildenden Kunst, des Spielfilms
und der Alltagskultur dokumentiert. Anlässlich des 60. Geburtstages der Bundesrepublik
Deutschland und 20 Jahren Mauerfall zeigt die Stiftung
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom
21. Mai – 11. Oktober 2009 die Ausstellung „Bilder
im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte“. Sie analysiert
die Entstehung, Verbreitung und Wirkkraft politischer Bilder
aus der Zeit des Nationalsozialismus, der DDR und der Bundesrepublik
Deutschland. Neben den Original-Fotografien wird auch deren
Verbreitung in Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten,
Büchern und anderen Publikationen sowie deren künstlerische
Adaption in Werken der Bildenden Kunst, des Spielfilms
und der Alltagskultur dokumentiert.
Bilder sind in der Mediengesellschaft allgegenwärtig
und prägen unsere Wahrnehmung der Gegenwart und der
Vergangenheit. Aus der Bilderflut ragen einige politische „Ikonen“ heraus:
Historische Bildikonen sind Schlüsselbilder, die im
kollektiven Gedächtnis als Abbild eines besonderen
Ereignisses gespeichert sind.
Sie dienen als konkrete Bezugspunkte unserer Erinnerung
und sind nicht austauschbar – auch wenn viele Bilddokumente
von einem historischen Ereignis existieren, so ist doch
nur eines zur Ikone aufgestiegen.
Grundvoraussetzungen dafür sind eine eingängige
Bildsprache, die Komplexität des Bildinhaltes und
ein möglichst großes Überraschungsmoment.
Im Fall von Conrad Schumann gelang es dem Fotografen Peter
Leibing genau den Augenblick des Sprungs einzufangen, ein
dramatischer Übergang zwischen Diktatur und Demokratie.
Entscheidendes Kriterium bei der Auswahl der Fallbeispiele
für die Bonner Ausstellung waren die Bedeutung und
der Bekanntheitsgrad der Bilder sowie deren Verankerung
im kollektiven Gedächtnis. Die Ausstellung fragt nach
der besonderen Kraft der Bilder: Woran misst sich die Qualität
eines Bildes? Weshalb werden bestimmte Bilder stärker
erinnert als andere? Wie ist ihre politisch-historische
Bedeutung zu bewerten? Die Auswahl – die keinen Kanon
konstruiert, geschweige denn postuliert – berücksichtigt
exemplarische Bilder aus den verschiedenen Epochen deutscher
Geschichte.
Die Stiftung hat mit verschiedenen Ausstellungsprojekten
zum kritischen Umgang mit modernen Bilddokumenten beigetragen. „Bilder,
die lügen“ hat die Manipulation von und mit
Bildern zum Gegenstand gehabt. „Bilder und Macht
im 20. Jahrhundert“ thematisierte die Bedeutung von
Politikerbildern als Mittel politischer Kommunikation.
Mit „Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte“ wird
diese Reihe abgeschlossen, die nach der Wirkkraft einzelner
Fotografien aus dem Bilderfundus der deutschen Zeitgeschichte
fragt.
„Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte“
Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag, 9 – 19
Uhr, Eintritt frei
|
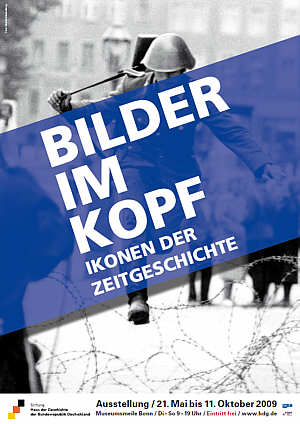 Anlässlich des 60. Geburtstages der Bundesrepublik
Deutschland und 20 Jahren Mauerfall zeigt die Stiftung
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom
21. Mai – 11. Oktober 2009 die Ausstellung „Bilder
im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte“. Sie analysiert
die Entstehung, Verbreitung und Wirkkraft politischer Bilder
aus der Zeit des Nationalsozialismus, der DDR und der Bundesrepublik
Deutschland. Neben den Original-Fotografien wird auch deren
Verbreitung in Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten,
Büchern und anderen Publikationen sowie deren künstlerische
Adaption in Werken der Bildenden Kunst, des Spielfilms
und der Alltagskultur dokumentiert.
Anlässlich des 60. Geburtstages der Bundesrepublik
Deutschland und 20 Jahren Mauerfall zeigt die Stiftung
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom
21. Mai – 11. Oktober 2009 die Ausstellung „Bilder
im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte“. Sie analysiert
die Entstehung, Verbreitung und Wirkkraft politischer Bilder
aus der Zeit des Nationalsozialismus, der DDR und der Bundesrepublik
Deutschland. Neben den Original-Fotografien wird auch deren
Verbreitung in Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten,
Büchern und anderen Publikationen sowie deren künstlerische
Adaption in Werken der Bildenden Kunst, des Spielfilms
und der Alltagskultur dokumentiert.