Haus der Bayerischen Geschichte, 2004
"Das Leben, Geschäft Arbeit und alles was damit zusamenhängt
hier ist es sehr Verschieden von dem in der Alten Heimad."
Diese Erfahrung machten viele Menschen, die als Auswanderer
aus Bayern ein neues Leben über dem Ozean begannen. Ihren
Spuren folgt die Ausstellung "Good Bye Bayern - Grüß Gott
America. Auswanderung aus Bayern nach Amerika 1683-2003",
die das Haus der Bayerischen Geschichte von Ende Juni bis
Ende September 2004 in der Alten Schranne in Nördlingen
präsentiert. Zahlreiche Exponate aus Deutschland und den
USA, multimediale Mittel, Zeitzeugeninterviews, Musik- und
Dialektbeispiele sowie einprägsame Inszenierungen zeigen
die Beweggründe der Auswanderer und ihr neues Leben in den
Vereinigten Staaten von Amerika.
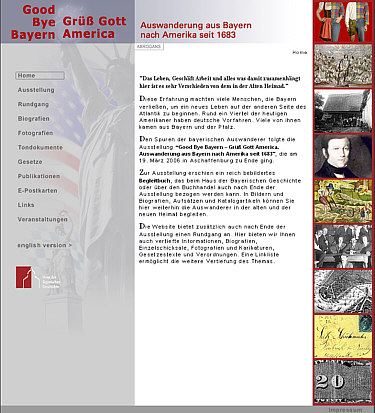 Deutsche
Vorfahren haben rund ein Viertel der Amerikaner. Viele davon
stammen aus Bayern und der bayerischen Pfalz, die im Verlauf
des 19. Jahrhunderts rund eine halbe Million Menschen legal
mit dem Ziel Amerika verließen. Obwohl dieser Strom im 20.
Jahrhundert nachließ, sind z.B. in den letzten 10 Jahren
immer noch rund 86.000 Menschen auf Zeit oder auf Dauer
aus Bayern in die USA gegangen.
Deutsche
Vorfahren haben rund ein Viertel der Amerikaner. Viele davon
stammen aus Bayern und der bayerischen Pfalz, die im Verlauf
des 19. Jahrhunderts rund eine halbe Million Menschen legal
mit dem Ziel Amerika verließen. Obwohl dieser Strom im 20.
Jahrhundert nachließ, sind z.B. in den letzten 10 Jahren
immer noch rund 86.000 Menschen auf Zeit oder auf Dauer
aus Bayern in die USA gegangen.
Neun Ausstellungsabteilungen mit rund 400 Exponaten veranschaulichen
das Geschehen; Einzel- und Sammelbiographien bringen dem
Besucher beispielhaft die Geschichte der Auswanderung nahe.
Die Berührungspunkte reichen weit zurück: Franz Daniel
Pastorius aus dem fränkischen Sommerhausen gründete 1683
Germantown in Pennsylvania. Ein Denkmal, das identisch in
Philadelphia und in Deutschland steht, erinnert bis heute
daran. Ihm folgten viele andere. Neben den bekannten, wie
Anton Wilhelm Faber aus Stein, der eine Bleistiftfabrik
in New York errichtete, dem Eisenbahnkönig Henry Villard
aus der Pfalz, dessen Büste bis heute in Speyer an die Unterstützung
für seine Heimatgemeinde erinnert, den aus dem fränkischen
Fürth stammenden Simon Ochs, der 1896 die "New York Times"
übernahm, Thomas Nast, den "Vater" von Santa Claus oder
Löw Strauss, den "Erfinder" der Blue Jeans aus Buttenheim
in Franken, stehen zahllose unbekannte. Wilhelm Bücherl
aus Waldmünchen errichtete in Brenham, Texas einen Saloon
und musste diesen krankheitshalber wieder aufgeben, der
Arzt Xaver Dodel aus Wolfertschwendten erlebte 1906 das
Erdbeben in San Francisco und berichtet darüber, der Musiker
Georg Drumm aus der Pfalz wird mit dem Marsch "Hail America"
berühmt. Eine interaktive Medien-Station macht mit vielen
weiteren Auswanderern bekannt.
Anlässe zur Auswanderung waren Not und Konflikte in der
alten Heimat, religiöse Intoleranz und politische Unterdrückung,
aber auch Abenteuerlust und Unternehmungsgeist. Der Immenstädter
Landtagsabgeordnete und Verfechter der Ideen der Revolution
von 1848, Fidel Schlund zum Beispiel, suchte für sich und
seine zahlreiche Familie in Amerika die Freiheit, die er
in Bayern vermisste. Ein Wechselbetrüger wollte sich der
Strafverfolgung entziehen, ein 13jähriger aus der Pfalz
plünderte sein Sparschwein und riss nach New Orleans aus.
Geistliche der christlichen Konfessionen betreuten die
Auswanderer. Bonifaz Wimmer aus dem bayerischen Kloster
Metten begründete die amerikanische Benediktinerkongregation
mit dem bis heute bestehenden Kloster St. Vincent. Evangelische
Auswanderer aus Franken gründeten durch die Initiative von
Pfarrer Wilhelm Löhe aus Neuendettelsau in den 1850er Jahren
z.B. Frankenmuth, Frankenhilf und Frankentrost im Staat
Michigan.
Die Verfolgung durch die nationalsozialistische Diktatur
hat viele deutsche Bürger entrechtet und gedemütigt aus
dem Lande gezwungen. Ihre Aufnahme in die USA rettete den
Flüchtlingen das Leben. Lion Feuchtwanger, Bertolt Brecht
und Oskar Maria Graf, Henry Kissinger, Leonhard Frank oder
Klaus und Erika Mann sind prominente Beispiele für die Emigration.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Bayern von amerikanischen
Soldaten besetzt, zu denen sich nach der Lockerung des "Fraternisierungsverbotes"
vielfältige Beziehungen ergaben. An der Seite ihrer amerikanischen
Männer suchten viele junge Frauen in den USA eine neue Heimat.
Ebenso öffneten sich die USA deutschen Studenten, Fachkräften
und Wissenschaftlern.
Die zunächst gefährliche, langwierige und entbehrungsreiche
Reise über den Ozean endete bei den Kontrollstellen der
amerikanischen Einwanderungsbehörden; in New York war dies
Castle Garden oder später Ellis Island. Beeindruckende Fotos
und einige authentische Fliesen, über die die Einwanderer
gingen, zeugen von der Unsicherheit und den Befürchtungen:
wird die Einreise gelingen?
Viele Einwanderer blieben in New York, viele machten sich
aber auch auf in die Gegend der großen Seen, suchten ihre
neue Heimat bevorzugt in Wisconsin, Illinois und Michigan,
bevölkerten die Städte Chicago oder Cincinnati. Weiter westlich
fotografierte der Klingenberger Auswanderer Christian Barthelmeß
in den 1880er Jahren im Dienst der amerikanischen Armee
die indianische Urbevölkerung. Dieser Fotobestand war noch
nie in Europa zu sehen und wird erstmals am ersten Ausstellungsstandort
Nördlingen gezeigt werden.
Der Austausch der Kulturen bildet den Schlusspunkt der
Ausstellung. Deutsche Gesellschaften in den Vereinigten
Staaten sorgten und sorgen bis heute für die Pflege von
Sprache und Kultur in der neuen Heimat, Kirchenfenster in
den Vereinigten Staaten stammten im 19. Jh. meist aus München,
die "Vereinigten Bayern von Groß-New York" finanzierten
die Restaurierung des Alten Peter und der Frauenkirche in
München nach dem Zweiten Weltkrieg und bayerisch-amerikanische
Volksfeste. "Little Oktoberfests" sind bis in die Gegenwart
eine Attraktion an zahlreichen Orten in den U.S.A.
Zur Ausstellung erscheint ein reich bebildertes Begleitbuch.
Ein umfänglicher Internetauftritt gibt die Möglichkeit,
die Inhalte der Ausstellung zu vertiefen und macht weitere
Exponate zugänglich. Führungen und museumspädagogische Programme
werden angeboten werden.
Im Internet: http://www.hdbg.de/auswanderung/deutsch/index2.htm