|
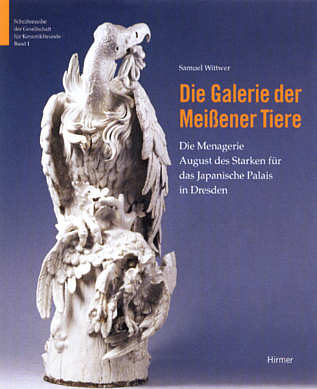 Schriftenreihe der Gesellschaft für Keramikfreunde, Band
l
Schriftenreihe der Gesellschaft für Keramikfreunde, Band
l
Samuel Wittwer
Die Galerie der Meißener Tiere
Die Menagerie August des Starken für das Japanische Palais
in Dresden
Ca. 336 Seiten mit ca. 218 Abbildungen, davon ca. 150 Abbildungen
in Farbe.
24 x 28 cm. Leinen.
München: Hirmer, 2004
Ca. € 85,- [D] /sFr 140,-*
ISBN 3-7774-2275-4
Zwei Hauptwerke der Dresdener Kunst um 1730 werden erstmals
in ihrer Wechselwirkung untersucht und in den zeitlichen,
räumlichen und künstlerischen Kontext des sächsischen Hofes
gestellt. Zahlreiche Quellenzitate und ein umfangreicher
Katalogteil machen diese Monographie überdies zu einem Nachschlagewerk
für eine der faszinierendsten Phasen der Meißner Porzellanmanufaktur.
Die
großformatigen Tierfiguren, die in der Manufaktur Meißen
zwischen 1731 und 1736 entstanden, stellen die wohl herausragendste
Leistung der Porzellankunst des 18. Jahrhunderts dar. Sie
waren für das Japanische Palais Augusts des Starken in Dresden
bestimmt. Im Zuge der Neuorganisierung der kurfürstlichen
Kunstsammlungen in Dresden war dieses Schloss in erster
Linie dazu bestimmt, die erstaunliche Sammlung ostasiatischer
Porzellane aufzunehmen. Noch während des Baus änderte der
Kurfürst die Planungen. Die oberen Räume sollten nunmehr
Porzellan seiner eigenen Manufaktur in Meißen aufnehmen
und, unterstützt von einem ausgeklügelten ikonografi-schen
Programm, die Überlegenheit der sächsischen Werke feiern.
Eine Sonderstellung nimmt hierbei eine Galerie ein, für
die mehrere hundert lebensgroße Tierplastiken bestellt wurden.
Die erst zwanzig Jahre alte Meißener Manufaktur war von
diesem
Auftrag sowohl künstlerisch als auch technisch überfordert.
Die erhaltenen Quellen, aber auch die Porzellanfiguren selbst,
legen beredtes Zeugnis davon ab, wie der Kampf um das Gelingen
der großformatigen Modelle über Jahre den Alltag der Manufaktur
dominierte, zu internen Spannungen führte und durch die
gesammelte Erfahrung schließlich entscheidend zum Triumphzug
des Meißener Porzellans beitrug. Von dieser zerbrechlichen
Menagerie lassen sich zahlreiche Verbindungen zu anderen
Tiersammlungen am Dresdener Hof knüpfen und die besondere
Stellung des Japanischen Palais unterstreichen. Als Ort
der Demonstration wirtschaftlicher und künstlerischer Potenziale
Sachsens bildete das Schloss auch das Pendant zu den naturwissenschaftlichen
Sammlungen im Zwinger, welchen in den 1730er Jahren ebenfalls
besondere Beachtung zukam. Es war eine Zeit der Umbrüche
in der Naturwissenschaft, die sich ebenso auf
ein verändertes Naturverständnis in der Kunst auswirkten.
Die zwei Hauptmeister der Meißener Großplastik, Johann Gottlieb
Kirchner und Johann Joachim Kaendler, sind Vertreter sowohl
der traditionellen als auch der neuen Sichtweise, wodurch
ihre Schöpfungen für die Menagerie des Japanischen Palais
gleichsam zu Zeugnissen verschiedener Strömungen spätbarocker
Kunst wurden.
Samuel Wittwer, Kustos der keramischen Sammlung der Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, studierte
Kunstwissenschaft, Volkskunde und Geschichte in Basel. Sein
Hauptinteresse gilt dem europäischen Porzellan des 18. Jahrhunderts
und dessen kulturhistorischen Hintergründen. Das Buch, welches
aus seiner Dissertation hervorgeht, ist zugleich der erste
Band einer neuen wissenschaftlichen Reihe der Deutschen
Gesellschaft der Keramikfreunde e.V.
|