 Das Antikenmuseum Basel geht neue Wege. In einer kleinen,
aber feinen Sonderausstellung präsentiert es Highlights
aus der eigenen Sammlung unter einem thematischen Gesichtspunkt:
Kommunikation in der Antike. Das Antikenmuseum Basel geht neue Wege. In einer kleinen,
aber feinen Sonderausstellung präsentiert es Highlights
aus der eigenen Sammlung unter einem thematischen Gesichtspunkt:
Kommunikation in der Antike.
Nach aufwendigen Sonderausstellungen mit Objekten,
die aus der ganzen Welt nach Basel reisten, rückt
das Antikenmuseum ab dem 26. März eigene Kunstwerke
in ein neues Licht: In einer Schau mit rund 80 vor allem
griechischen und römischen Exponaten zeigt es, wie
die Menschen in der Antike Botschaften durch Bilder übermittelten.
Die Ausstellung führt in eine Welt ohne Zeitungen,
Computer und Handys, in der die meisten Menschen nur wenig
lesen und schreiben konnten. Hier waren Darstellungen auf
Gefässen, Gebäuden oder Grabsteinen wichtiger
als Texte, um das damalige Zeitgeschehen zu verstehen.
Das Kuratorenteam zeigt auf, welche Botschaften die antiken
Bilder den Zeitgenossen vermittelten: „Figuren und
ihre Gesten zeigen, welche Normen und Symbole in der damaligen
Gesellschaft verbindlich waren“ erklärt Direktor
Peter Blome. So ermahnten zum Beispiel Darstellungen auf
Grabsteinen die Hinterbliebenen, die Gräber regelmässig
zu pflegen, um die Seelen der Toten zu besänftigen.
Themen
Die Ausstellung beleuchtet sechs
Themen:
 Bei der Kommunikation zwischen Mann und Frau sehen
die Besucherinnen und Besucher
beispielsweise, wie junge Athener Adlige eine Animierdame
ansprachen oder weshalb der Blick einer Frau im antiken
Griechenland Unheil verheissen konnte. Da im Athen des 5.
Jahrhunderts v. Chr. Bescheidenheit, sexuelle Schamhaftigkeit,
Diskretion und Würde die Schlagworte für das
gute Benehmen einer Frau waren, zeigte sie ihre gute Erziehung,
indem sie bescheidene und korrekte Kleidung trug, den Kopf
gesenkt hatte und die Augen im Gespräch mit einem
Mann nach unten richtete. Vor der erotischen Macht des
weiblichen Augenaufschlags hatten die Männer Angst.
Flirten war für „ehrsame“ Frauen unnötig
und nur den Hetären vorbehalten. Bei der Kommunikation zwischen Mann und Frau sehen
die Besucherinnen und Besucher
beispielsweise, wie junge Athener Adlige eine Animierdame
ansprachen oder weshalb der Blick einer Frau im antiken
Griechenland Unheil verheissen konnte. Da im Athen des 5.
Jahrhunderts v. Chr. Bescheidenheit, sexuelle Schamhaftigkeit,
Diskretion und Würde die Schlagworte für das
gute Benehmen einer Frau waren, zeigte sie ihre gute Erziehung,
indem sie bescheidene und korrekte Kleidung trug, den Kopf
gesenkt hatte und die Augen im Gespräch mit einem
Mann nach unten richtete. Vor der erotischen Macht des
weiblichen Augenaufschlags hatten die Männer Angst.
Flirten war für „ehrsame“ Frauen unnötig
und nur den Hetären vorbehalten.
Beim Thema Männer
unter sich – Frauen unter sich beleuchtet
die Ausstellung typische Frauen- und Männerorte: Das
sind für Männer das Heerlager, das Gelage oder die Agora,
wo dikutiert und politisiert wird, für die jüngeren Männer
die Palästra,
für Lehrer und Schüler das Gymnasion.
Im Gespräch zwischen älteren und jüngeren Männern schwingt
oft eine erotische Komponente
mit. Nur an bestimmten Heiligtümern konnten Frauen
ganz unter sich feiern, ansonsten blieben sie auf das Haus
beschränkt.
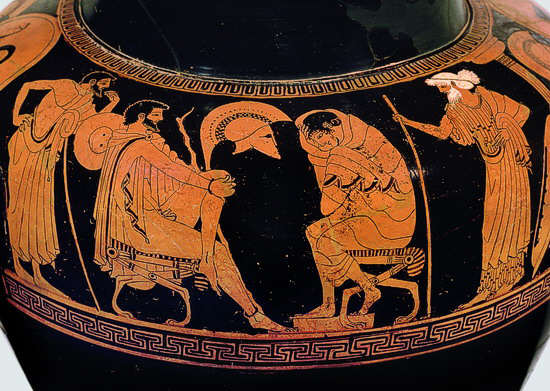
Weingefäß (Stamnos) aus Athen; Ton;
um 480 v. Chr. © Antikenmuseum Basel,
Inv. BS 477, Foto: Andreas F. Voegelin
Im Abschnitt Kommunikation innerhalb
der Familie werden die verschiedenen Stationen
einer griechischen Hochzeit dargestellt. Mit ihr trat die
junge Frau vom Haushalt des Vaters in den Haushalt des
Ehemannes über, dem sie Kinder und Erben zu gebären hatte.
Die Erziehung der Mädchen bereitete diese - mit dem Erlernen
der handwerklichen Fähigkeiten wie Wegen oder Nähen - auf
ihre künftige Rolle im Haushalt vor, während Knaben Lesen
und Schreiben, Musik und Sport lernten.Die
Familie als Ganzes trat vor allem bei religiösen Festen
in Erscheinung, wie z.B. beid en Festen für den Weingott
Dionysos, an dem schon kleine Knaben an Wetttrinken teilnahmen.
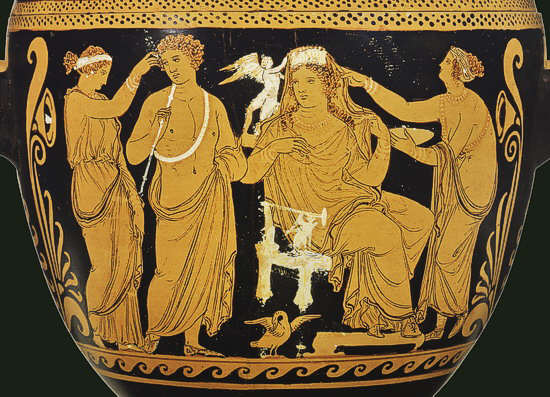
Büchse mit Deckel in Form eines Trink
bechers (Skyphos-Pyxis) aus Sizilien; Ton; um 340 v. Chr. © Antikenmuseum
Basel, Inv. BS 478, Foto: Andreas F. Voegelin
Die politische Kommunikation wird am
besten am Beispiel römischer
Portraits deutlich. Sie waren das Bindeglied für das Riesenreich,
da einerseits auf den Münzen, andererseits in den zahlreichen
ausgestellten Porträtbüsten und Herrscherstatuen der Kaiser
im gesamten Reich präsent war. Das Bildnis des Kaisers
war oft idealisiert, er erschien ewig jung, selten wurde
er realistisch dargestellt. Privatleute ahmten den Stil
der Kaiserporträts für sich nach, die vornehmen Damen nahmen
die Frisur der Kaiserinnen als Vorbild. Das Porträt eines
politischen Gegners (oft nach seinem Tod) zu zerstören,
ihn der "damnatio memoriae" verfallen zu lassen, galt als
übliche Rache.
Bei der Kommunikation mit den Toten traten
die Hinterbliebenen durch Opferhandlungen am Grab mit den
Verstorbenen
in Verbindung. Nach dem Glauben der Griechen waren die
Toten im Reich der Unterwelt, in das sie durch den
Götterboten
Hermes geleitet wurden und von wo es keine Rückkehr mehr
gab. Die Totenrituale sollten vor allem die Toten besänftigen
und sie davon abhalten, sich an den Lebenden zu rächen,
weswegen solche Handlungen sehr oft auf den Grabdenkmälern
dargestellt sind.
Schliesslich beleuchtet die Kommunikation
mit den Göttern, wie die alten Griechen mit
ihren Gottheiten in Kontakt traten – sei es im Gebet,
in schwer verständlichen Orakeln oder indem die Götter
den Menschen erschienen. Zunächst bezeugte hier das
Kultbild, dass der Gott lebendig da und ansprechbar war.
Von unzähligen Statuetten, die die Menschen in Heiligtümern
deponierten, wissen wir, dass die Menschen vor ihren Göttern
in Gebets- und Grusshaltung, häufig
mit Geschenken in der Hand, standen. Sie begegneten ihnen
mit Sehnsucht, Hingabe und Dankbarkeit.
Den Kontakt mit den Göttern vermittelten vor allem
die Rituale am Altar vor dem Tempel: Unter Anleitung eines
Priesters wurde gebetet und gesungen, wurden
Flüssigkeiten vergossen und
Tiere geopfert.
Opfern (lat. operari, handeln) bedeutete ein symbolisches
Blutvergiessen, das die Kontaktaufnahme
mit den Göttern garantierte. Antworten erhielten die
Menschen häufig als Naturereignis:
Ein Erdbeben, ein Gewitter, eine Sonnenfinsternis,
eine Seuche oder ein Traum vermittelten den
Willen der Götter. Auch der Vogelflug oder die Lage
der Eingeweide in einem Opfertier wurden als Signale der
Götter gedeutet..
Die Fantasie der Besucherinnen und Besucher ist gefordert!
Nicht alle antiken Bilder lassen sich zweifelsfrei interpretieren.
Die Ideen der Besucherinnen und Besucher sind gefragt:
Diese sind zu einem Wettbewerb eingeladen, in dem sie selbst
antike Szenen interpretieren. Die originellsten Ideen werden
prämiert.
Für Schulklassen wird folgender Workshop angeboten: „Reise
in die antike Welt… Aber das Handy bleibt daheim.“
Aufbau
Die Ausstellung gliedert sich in zwei Teile: In einem Kernraum
im Erdgeschoss bekommen die Besucherinnen und Besucher
anhand ausgewählter Kunstwerke einen Überblick über
alle Themen. Danach können sie mit Hilfe einer Broschüre
durch die herausragende Dauersammlung des Museums streifen
und sich weitere Exponate ansehen, die zu den Themen
der Ausstellung gehören. Diese Objekte sind im ganzen
Haus verteilt und in den Vitrinen klar gekennzeichnet.
Die reich bebilderte Broschüre im Pocket-Format
erklärt die Exponate und kann mit nach Hause genommen
werden.
|