|
Die Erforschung von Todesriten ist eine spannende Konfrontation
mit der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Beim historischen
Rückblick auf die Auseinandersetzung des Menschen mit dem
Tod werden Konstanten ebenso deutlich wie Weiterentwicklungen
und Brüche.
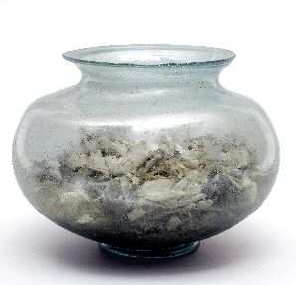 Ziel
dieser Rituale ist immer, den Leichnam eines Verstorbenen
im Einklang mit den Glaubensvorstellungen der jeweiligen
Epoche so effizient wie möglich zu beseitigen. Im Elsass
lässt sich besonders anschaulich nachvollziehen, auf welch
komplexe Weise die Lebenden von der Vorgeschichte bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts den Dialog mit dem Tod führten.
Denn diese Region, in der die archäologische Forschung sehr
aussagekräftige Zeugnisse zutage förderte, zeichnet sich
durch vielfältige Traditionen, ein sehr offenes religiöses
und soziales Umfeld sowie ein breites Spektrum an spezifischen
Formen der Sepulkralkunst aus. Ziel
dieser Rituale ist immer, den Leichnam eines Verstorbenen
im Einklang mit den Glaubensvorstellungen der jeweiligen
Epoche so effizient wie möglich zu beseitigen. Im Elsass
lässt sich besonders anschaulich nachvollziehen, auf welch
komplexe Weise die Lebenden von der Vorgeschichte bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts den Dialog mit dem Tod führten.
Denn diese Region, in der die archäologische Forschung sehr
aussagekräftige Zeugnisse zutage förderte, zeichnet sich
durch vielfältige Traditionen, ein sehr offenes religiöses
und soziales Umfeld sowie ein breites Spektrum an spezifischen
Formen der Sepulkralkunst aus.
Für die am weitesten zurückliegenden geschichtlichen Epochen,
insbesondere für Zivilisationen ohne Schrift, stellt die
archäologische Forschung die einzige Informationsquelle
dar. Durch die Untersuchung der vom Menschen hinterlassenen
materiellen Zeugnisse (Grabstätten, Grabbeigaben, Opfergaben,
Grabstelen) lassen sich Rückschlüsse auf die an den Tod
geknüpften Glaubensvorstellungen und Riten ziehen. Der Weg
eines Verstorbenen ins Jenseits wurde von zahlreichen Praktiken,
Mythen und Glauben begleitet. Dies trifft auf die ersten
Grabstätten in der späten Altsteinzeit und die ersten Gräberfelder
der sesshaft gewordenen Jungsteinzeitmenschen ebenso zu
wie auf die Bestattungsriten der römischen Antike und des
frühen Mittelalters.
Im Mittelalter wurde die Kirche zur hauptsächlichen Organisatorin
von Bestattungen. Sie kanalisierte die verschiedenen Praktiken
und versammelte dazu die Gräber in der nächsten Umgebung
von Kapellen und Kirchen auf eigens dafür bestimmtem Boden.
In den sehr komplexen barocken Bestattungszeremonien des
späten 16. und des 17. Jahrhunderts wurde der Tod in Szene
gesetzt, wobei das Ziel in der christlichen Erbauung der
Lebenden bestand. Erst ab Ende des 18. Jahrhunderts ist
eine Säkularisierung der mit dem Tod zusammenhängenden Praktiken
zu beobachten. In dieser Zeit entstanden große Friedhöfe
an den Stadträndern. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts spiegelten
die vielfältigen Grabmäler dieser "Totenstädte" mit ihrer
facettenreichen Symbolik und ihrer von einer hoch entwickelten
Bestattungskunst zur Geltung gebrachten Themenvielfalt die
Welt der Lebenden und die gesellschaftliche Organisation
der jeweiligen Zeit wider.
In ländlichen Gebieten des Elsass versuchte man im 19.
Jahrhundert, den Tod durch eine ausgesprochen strikte Ritualisierung
zu kanalisieren. Dies sollte dem Verstorbenen den guten
Verlauf seiner "Reise" ins Jenseits aber auch sein Weiterleben
in der kollektiven Vorstellung gewährleisten. Hier spielten
die unterschiedlichen Ausprägungen von Aberglauben sowie
Legenden eine Rolle. Für die dörfliche Gemeinschaft waren
der Tod eines ihrer Mitglieder und die Konfrontation mit
der Unausweichlichkeit der Trennung oft Anlass, um Einigkeit
zu demonstrieren und die Reihen enger zu schließen.
Ebenfalls mit dem Tod befasst sich in Verlängerung der
Schau des Archäologischen Museums eine Ausstellung des Archivs
der Stadt und der Stadtgemeinschaft Straßburg (32, route
du Rhin, 19. Januar bis 20. Juni 2009). Der den Akzent liegt
dabei jedoch auf Straßburg und seiner näheren Umgebung.
Bild: Glasurne mit Leichenbrand, römisch.
|